|
>
Steuerrecht
>
Gesellschaftsrecht
>
Arbeitsrecht

 Europarecht
Europarecht
 Deutsches
Recht
Deutsches
Recht
 Französisches
Recht
Französisches
Recht

 Grenzüberschreitende
Lieferungen
zwischen
Mutter- und
Tochtergesellschaften
Grenzüberschreitende
Lieferungen
zwischen
Mutter- und
Tochtergesellschaften
Um
eine
Doppelbesteuerung
von durch
eine
Tochtergesellschaft
an ihre
Muttergesellschaft
ausgezahlten
Dividenden
zu vermeiden,
sieht
Artikel 216
des französischen
Allgemeinen
Steuergesetzbuchs
(„Code Général
des Impôts“)
die Möglichkeit
der
Muttergesellschaft
vor, Erträge
aus
Beteiligungen
an ihrer
Tochtergesellschaft
bis auf
einen Anteil
für
Ausgaben und
Aufwendungen
von ihrem zu
versteuernden
Gewinn
abzuziehen.
Der
steuerpflichtige
Anteil für
Auslagen und
Aufwendungen
beträgt
dabei 5% des
Gesamtertrags
aus den
Beteiligungen
einschließlich
der
Steuergutschrift
und wird in
den zu
versteuernden
Gewinn der
Muttergesellschaft
reintegriert.
Im
Rahmen einer
von ihm zu
entscheidenden
Anfechtungsklage
gegen eine
in Bezug auf
Artikel 216
des
Steuergesetzbuchs
ergangene
fiskalische
Weisung hat
das oberste
französische
Verwaltungsgericht
dem Europäischen
Gerichtshof
die Frage
vorgelegt,
ob die in
Frankreich
praktizierte
Berechnung
des Anteils
für
Auslagen und
Aufwendungen
mit der
Richtlinie
90/435/CEE
über das
gemeinsame
Steuersystem
der Mutter-
und
Tochtergesellschaften
verschiedener
Mitgliedstaaten
vereinbar
sei.
In
einer mit
Spannung
erwarteten
Entscheidung
hat sich der
Gerichtshof
daraufhin am
03. April
2008 darüber
ausgesprochen,
ob es mit
der
Richtlinie
über das
gemeinsame
Steuersystem
der Mutter-
und
Tochtergesellschaften
verschiedener
Mitgliedstaaten
vereinbar
ist, dass im
Rahmen der
Berechnung
des Anteils
von 5%
nicht nur
Inlandssteuergutschriften,
sondern auch
Auslandssteuergutschriften
berücksichtigt
werden.
Der
Gerichtshof
hat dabei
angenommen,
dass es der
Begriff der
„von der
Tochtergesellschaft
ausgeschütteten
Gewinne“ im
Sinne der
oben
genannten
Richtlinie
nicht
ausschließt,
Steuergutschriften
in diese
Gewinne
nicht
einzubeziehen,
die gewährt
wurden, um
einen
Steuerabzug
an der
Quelle
auszugleichen,
den der
Mitgliedstaat
der
Tochtergesellschaft
bei der
Muttergesellschaft
vorgenommen
hat. Die
Wirksamkeit
der französischen
Vorschrift
ist damit
bestätigt
worden.
Europäischer
Gerichtshof,
Urteil vom
03. April
2008,
C-27/07,
Banque Fédérative
du Crédit
Mutuel

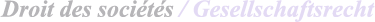
 Laufendes
Gesellschafterkonto
und
Anteilsabtretung
Laufendes
Gesellschafterkonto
und
Anteilsabtretung
Das
Berufungsgericht
Versailles
hat kürzlich
eine
Rechtssprechung
bestätigt,
nach mit der
Abtretung
von Geschäftsanteilen
oder von
Aktien nicht
automatisch
auch das
laufende
Gesellschafterkonto
auf den
Zessionar übertragen
wird.
Insofern
gilt zu
bedenken,
dass das
laufende
Gesellschafterkonto
nicht auf
dem Eigentum
an den
Anteilen
beruht,
sondern auf
das
Gesellschafterdarlehen
beruht.
Durch das
Darlehen
wird der
Gesellschafter
Gläubiger
der
Gesellschaft.
Diese Gläubigereigenschaft
ist von der
Gesellschafterstellung
zu trennen.
Andererseits
können die
Parteien in
einem
Abtretungsvertrag
sehr wohl
durch eine
ausdrückliche
Vertragsbestimmung
vorsehen,
dass das
Gesellschafterkonto
bei der
Abtretung
der Anteile
mit übergehen
soll. Eine
solche
Klausel muss
allerdings
präzis sein
und den Übergang
des
Gesellschafterkontos
ausdrücklich
vorsehen.
Berufungsgericht
Versailles,
25.
September
2007, Nr.
06-6222,
Guirguis ./.
Fifre
 Unwirksamkeit
der
Amtsniederlegung
eines
Geschäftsführers
Unwirksamkeit
der
Amtsniederlegung
eines
Geschäftsführers
In
einem kürzlich
vom OLG Köln
zu
entscheidenden
Fall griff
der
Alleingeschäftsführer
einer GmbH
die
Ablehnung
der
Eintragung
seiner
Amtsniederlegung
durch das
Registergericht
an. Das
Registergericht
hatte die
beantragte
Eintragung
abgelehnt,
da knapp
drei Wochen
zuvor ein
Insolvenzantrag
über das
Vermögen
der
betroffenen
GmbH
gestellt
worden war
und der
Alleingeschäftsführer
keinen
Nachfolger
benannte.
In
seiner
Entscheidung
hat das OLG
Köln darauf
hingewiesen,
dass die von
einem Geschäftsführer
einer GmbH
erklärte
Amtsniederlegung
zwar auch
ohne
Vorliegen
wichtiger Gründe
grundsätzlich
wirksam ist,
jedoch im
Falle des
Rechtsmissbrauchs
eine
Ausnahme
gilt. Bisher
wurde ein
Rechtsmissbrauch
in der Rspr.
dabei regelmäßig
dann
angenommen,
wenn es sich
bei dem
niederlegenden
Geschäftsführer
um den
Alleingeschäftsführer
handelte,
dieser
zugleich
alleiniger
Gesellschafter
war und
davon absah,
einen neuen
Geschäftsführer
für die
Gesellschaft
zu bestellen.
Das
OLG Köln
hat nunmehr
entschieden,
dass auch
die von
einem
Alleingeschäftsführer
und
Mehrheitsgesellschafter
einer GmbH
erklärte
Amtsniederlegung
wegen
Rechtsmissbräuchlichkeit
unwirksam
sein kann,
wenn nicht
zugleich ein
Nachfolger
bestellt
wird.
Ausschlaggebend
ist dabei,
ob der
niederlegende
Gesellschafter
und Geschäftsführer
insbesondere
durch seine
Mehrheitsbeteiligung
einen
solchen
Einfluss auf
die
Gesellschaft
hat, dass er
durch die
Amtsniederlegung
eine
Handlungsunfähigkeit
der
Gesellschaft
auslösen
kann. Liegt
ein solcher
Fall vor,
kann auch
von einem
Mehrheitsgesellschafter
verlangt
werden, dass
er sich um
die
Bestellung
eines
Nachfolgers
bemüht,
wenn er sein
Amt ohne
wichtigen
Grund
niederlegen
möchte.
OLG
Köln, Urt.
v.
01.02.2008,
Az. : 2
Wx 3/08

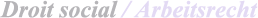
 Das
neue
französische
Arbeitsgesetzbuch
Das
neue
französische
Arbeitsgesetzbuch
Das
neue französische
Arbeitsgesetzbuch
ist am 1.
Mai
2008 in
Kraft
getreten.
Die
Bestimmungen
wurden
grundsätzlich
nicht geändert.
Manche sind
abgeschafft
worden, weil
sie zu alt
oder unnötig
waren,
andere
wurden in
andere
Gesetzbücher
eingefügt.
Die
gesetzlichen
Normen, die
nicht
kodifiziert
waren, sind
jetzt in dem
neuen
Arbeitgesetzbuch
enthalten,
so wie das
Gesetz über
die
monatliche
Zahlung, die
Regelung der
Restaurant-Tickets
oder die
Erstattung
der
Transportgebühren.
Die
Gliederung
hat sich
sowohl für
den
gesetzlichen
Teil als
auch für
den
Ordnungsteil
geändert.
Die Artikel
des alten
Gesetzbuches,
die meistens
aus mehreren
Absätzen
bestanden,
wurden so
aufgespaltet,
dass jeder
Artikel
jetzt nur
noch ein
Prinzip
darstellt.
Die
Nummerierung
besteht aus
3 bis 4
Nummern.
Das
Ziel der
Reform ist
es, das
Arbeitgesetzbuch
klarer und
einfacher
verständlich
für die
Benutzer zu
machen.
Das
neue
Gesetzbuch
ordnet
folgendes
an:
-
Erster
Teil:
Einzelarbeitsverhältnisse.
In
diesem Teil
geht es um
Ausbildung,
Durchführung
und Bruch
des
Arbeitsvertrages,
wie um das
Arbeitsgericht
(Artikel
L.1111-1 bis
L.1532-1 ;
R.1111-1 bis
1523-5).
-
Zweiter
Teil:
Kollektivarbeitsverhältnisse.
Dieser
Teil handelt
von
Arbeitergewerkschaften,
kollektiven
Verhandlungen,
Personalvertretern,
kollektiven
Konflikten (Artikel
L.2111-1 bis
L.2632-2).
-
Dritter
Teil:
Arbeitsdauer,
Lohn,
Gewinnbeteiligung,
Teilnahme
und
Lohnersparung
(Artikel
L.3111-1 bis
L.3431-1,
R.3121-1 bis
D3423-10).
-
Vierter
Teil:
Gesundheit
und
Arbeitssicherheit
(Artikel
L.4111-1 bis
L.4831-1;
R.4121-1 bis
R.4822-1).
-
Fünfter
Teil: Arbeit.
Dieser
Teil
behandelt
die
Arbeitsbeihilfevorrichtungen
und die
staatliche
Einrichtungen
im Bereich
Arbeit (Artikel
L.5111-1 bis
L.5531-1;
R.5111-1 bis
R.5531-1).
-
Sechster
Teil:
Berufliche
Ausbildung.
Dieser
Teil
behandelt
die
Bestimmungen
in Bezug auf
Lehre,
lebenslange
berufliche
Weiterbildung
und die
Wertung der
erworbenen
Erfahrung (Artikel
L.6111-1 bis
L.6524-1;
D.6112-1 bis
R.6523-14).
-
Siebter
Teil:
Spezielle
Regeln bei
bestimmten
Berufen und
Tätigkeiten
(Artikel
L.7111-1 bis
L.7521-1 ;
R.7111-1 bis
D.7522-1)
-
Achter
Teil:
Kontrolle über
Anwendung
der
Arbeitsgesetzgebung.
Dieser
Teil handelt
von der
Arbeitsaufsichtsbehörde
und der Bekämpfung
unwiderrechtlicher
Arbeit (Artikel
L.8112-1 bis
L.8331-1 ;
R.8111-1 bis
R.8323-2).
Gesetz
n°2008-67
vom 21.
Januar 2008,
JO 22 Januar
2008
 Anfechtbarkeit
einer
betriebsbedingte
Kündigung
nach
Abschluss
eines „Übereinkommens
zur
beruflichen
Wiedereingliederung „
(CRP)
Anfechtbarkeit
einer
betriebsbedingte
Kündigung
nach
Abschluss
eines „Übereinkommens
zur
beruflichen
Wiedereingliederung „
(CRP)
Das
französische
Kassationsgericht
hat seine
bisherige
Rechtssprechung
in Bezug auf
Übereinkommen
zur
Wiedereingliederung
bestätigt.
Nach dieser
Rechtsprechung
hat der
Arbeitnehmer
auch nach
dem
Abschluss
eines
solchen Übereinkommens
die Möglichkeit,
die
betriebsbedingten
Gründe der
Beendigung
seines
Arbeitsvertrages
zu
bestreiten.
Nach
dem französischen
Vorschriften
muss der
Arbeitgeber
dem
betroffenen
Arbeitnehmer
vor einer
betriebsbedingten
Beendigung
seines
Arbeitsvertrages
den
Abschluss
eines auf
ihn
zugeschnittenen
Übereinkommens
zur
beruflichen
Wiedereingliederung
anbieten,
sofern der
Betrieb
weniger
als 1000
Arbeitnehmer
umfasst (französisches
Arbeitsgesetzbuch
Artikel
Z.321-4-
2 a
.F., Artikel
Z. 1233-65
ff. n.F.).
Der
Gesetzgeber
hat dabei
ausdrücklich
vorgesehen,
dass der
Abschluss
eines
solchen Übereinkommens
zur
einvernehmlichen
Beendigung
des
Arbeitsvertrages
führt.
Das
Kassationsgericht
(s.o.)
beharrt
dagegen
darauf, die
Wirksamkeit
der
Vertragsbeendigung
trotz deren
„Einvernehmlichkeit“
anhand der
Vorschriften
über die Kündigung
zu überprüfen
und führt
aus: „Der
Abschluss
eines „Übereinkommens
zur
beruflichen
Wiedereingliederung“
durch den
Arbeitnehmer
bewirkt zwar
die
einvernehmliche
Beendigung
des
Arbeitsvertrages,
hindert den
Arbeitnehmer
jedoch nicht
daran, den
betriebsbedingten
Grund der
Vertragsbeendigung
anzufechten.“
Cass.
soc., 05. März
2008, n°07-41.964,
Benard c/ Sté
Auto
self-service
Stellungnahme
des
Kassationsgerichts
n°0080001P
vom 07.
April 2008
 Computer
gehört
nicht zur
„Normalausstattung“
des
Betriebsrats
Computer
gehört
nicht zur
„Normalausstattung“
des
Betriebsrats
Das
Bundesarbeitsgericht
hat in
diesem
Beschluss
vom 15. Mai
2007 seine
Rechtsprechung
bestätigt,
dass der
Betriebsrat
nur dann die
Anschaffung
eines PC
nebst Zubehör
und Software
gem. § 40
Abs. 2
BetrVG
fordern kann,
wenn diese
Sachmittel
zur Durchführung
seiner
Aufgaben
erforderlich
sind.
In
dem zu
entscheidenden
Fall hatte
der
Betriebsrat
eines
Unternehmens,
das
bundesweit
Drogeriemärkte
betreibt,
die
Anschaffung
eines
Computers
nebst Zubehör
und Software
gefordert.
Zur Begründung
führte er
an, dass ein
PC der
Beschleunigung
der
Betriebsratsarbeit
diene, weil
Schreibarbeiten
schneller
und
effektiver
mit einem PC
als mit der
Schreibmaschine
erstellt
werden könnten.
Außerdem
gehöre der
PC zu dem üblichen
technischen
Niveau der
Kommunikationsmittel.
Weder die
einzelnen
Verkaufsstellen
des
Unternehmens
noch der
regelmäßige
Ansprechpartner
des
Betriebsrats
in
personellen
und sozialen
Angelegenheiten
(Bezirksleiter)
verfügten
jedoch über
einen PC.
In
diesem
Beschluss
bekräftigt
das
Bundesarbeitsgericht
die
Auffassung
des
Landesarbeitsgerichts
Düsseldorf,
dass auf
Grund der in
dem Fall
vorliegenden
betrieblichen
Arbeitsorganisation
die Nutzung
eines
Computers
nicht
betriebsüblich
ist. Ferner
wird in
dieser
Entscheidung
klargestellt,
dass es
keinen
Anspruch des
Betriebsrats
auf Überlassung
einer nicht
näher
definierten
„Normalausstattung“
gibt,
sondern der
Betriebsrat
im
Einzelfall
zu begründen
hat, weshalb
dieses
Sachmittel
gerade zur
Erfüllung
seiner
betriebsverfassungsrechtlichen
Aufgaben erforderlich
ist. Eine
leichtere
oder
rationellere
Erledigung
der
Betriebsratsaufgaben
reiche zur
Begründung
der
Erforderlichkeit
nicht aus.
Der
Betriebsrat
müsse
konkret
darlegen,
dass er ohne
diese
Ausstattung
seine
anderen
Aufgaben
vernachlässigen
müsste.
Bundesarbeitsgericht,
Beschluss
vom 15. Mai
2007, 7 ABR
45/06
|