|
>
Steuerrecht
>
Gesellschaftsrecht
>
Arbeitsrecht
>
Insolvenzrecht

 Europarecht
Europarecht
 Deutsches
Recht
Deutsches
Recht
 Französisches
Recht
Französisches
Recht

 Vorherige
Mängelanzeigepflichten
Vorherige
Mängelanzeigepflichten
Will
ein
Steuerzahler
gegen eine
Steuereinziehung
vorgehen,
weil er die
Erhebung
ungerechtfertigt
oder
unregelmäßig
findet, so
kann er
Widerspruch
einlegen,
gegen:
-
die
Ordnungsmäßigkeit
des
Erhebungsbescheids
oder die
Modalitäten
der
Geltendmachung
-
die
Existenz,
den
Anteil
oder die
Fälligkeit
seiner
Verpflichtung
gegenüber
dem
Fiskus (oder
jeden
anderen
Grund,
der
nicht
die
Bemessungsgrundlage
und die
Steuerberechnung
betrifft).
Der
Widerspruch
muss
innerhalb
von zwei
Monaten
eingelegt
werden, da
er sonst
nichtig ist.
In
einem Urteil
vom 25. Mai
2007
entschied
der Conseil
d'Etat (oberstes
französisches
Verwaltungsgericht),
dass die
Steuerbehörde
in ihren
Bescheiden
die Fristen
und
Rechtsmittel
benennen
muss, über
die die
Steuerzahler
verfügen,
um gegen die
Steuereinziehung
vorzugehen.
Fehlen
diese
Angaben, so
ist die dem
Steuerzahler
gesetzte
Frist von
zwei Monaten,
um Mängel
anzuzeigen,
unwirksam.
Durch
dieses
Urteil, das
der seit
Jahren
konstanten
Rechtsprechung
des Cour de
Cassation (französischer
Kassationsgerichtshof
) entspricht,
setzt der
Conseil d’Etat
dem Zögern
der
Verwaltungsrichter
der
Sachinstanz
ein Ende.
(CE
25 mai 2007
n° 285747)
 Neues
Doppelbesteuerungsabkommen
über
Erbschaft
und
Schenkung
zwischen
Frankreich
und
Deutschland
Neues
Doppelbesteuerungsabkommen
über
Erbschaft
und
Schenkung
zwischen
Frankreich
und
Deutschland
Grenzüberschreitende
Erbschafts-
und
Schenkungsfälle
führen nach
dem gegenwärtigen
Rechtszustand
oft zu einer
gleichzeitigen
Besteuerung
in
Frankreich
und
Deutschland.
Derartige
steuerliche
Hindernisse
sollen durch
ein neues
Doppelbesteuerungsabkommen
zwischen den
beiden Ländern
abgebaut
werden.
Als
Anknüpfungspunkt
der
Besteuerung
sieht das
Abkommen den
Wohnsitz des
Erblassers
oder des
Schenkers
an, der
grundsätzlich
nach dem
innerstaatlichen
Recht der
Vertragsstaaten
ermittelt
wird. Ist
der
Erblasser
oder
Schenker in
beiden
Vertragsstaaten
ansässig,
so wird
einer der
beiden
Staaten als
Wohnsitzstaat
bestimmt. Für
die
Ermittlung
des
Wohnsitzstaats
werden dabei,
wenn der
Erblasser
oder
Schenker
eine natürliche
Person ist,
die
Kriterien
der ständigen
Wohnstätte,
des
Mittelpunkts
der
Lebensinteressen
und des gewöhnlichen
Aufenthalts
herangezogen.
Bei anderen
als natürlichen
Personen ist
der Ort der
tatsächlichen
Geschäftsleitung
ausschlaggebend.
Das
Abkommen
sieht die
Besteuerung
jedoch nicht
nur im
Wohnsitzstaat
vor.
Unbewegliches
Vermögen,
Betriebsstätten
und
bestimmtes
bewegliches
Vermögen können
vielmehr
auch im
Belegenheitsstaat
besteuert
werden.
Dabei ist zu
beachten,
dass als
unbewegliches
Vermögen im
Sinne des
Abkommens
auch Aktien,
Anteile und
sonstige
Rechte an
Gesellschaften
gelten, wenn
das Vermögen
der
betroffenen
Gesellschaft
unmittelbar
oder
mittelbar zu
mehr als der
Hälfte aus
in
Deutschland
oder
Frankreich
gelegenen
Immobilien
besteht; es
sei denn,
die
Immobilie
wird von der
Gesellschaft
für ihren
eigenen
gewerblichen
oder land-
und
forstwirtschaftlichen
Bedarf
genutzt bzw.
dient ihrer
selbstständigen
Tätigkeit.
Als Teil des
Nachlasses
oder der
Schenkung
werden
Rechte an
einer
Gesellschaft
dabei jedoch
nur dann
angesehen,
wenn der
Erblasser
oder
Schenker
allein oder
gemeinsam
mit nahen
Angehörigen
unmittelbar
oder
mittelbar
mehr als die
Hälfte der
Rechte an
dieser
Gesellschaft
hält.
Kann
ein Vermögenswert
nach dem
Abkommen in
beiden
Vertragsstaaten
besteuert
werden, so
wird die
Doppelbesteuerung
dadurch
vermieden,
dass der
Wohnsitzstaat
eine
Anrechnung
der im
anderen
Staat
gezahlten
Steuer
vornimmt.
Der
Anrechnungsbetrag
ist dabei
auf die Höhe
der Steuer
begrenzt,
die im
Anrechnungsstaat
auf den im
anderen
Staat
besteuerten
Vermögensteil
entfallen würde.
Das
Abkommen
bedarf zu
seinem
Inkrafttreten
noch der
Ratifikation.
Das hierfür
in
Deutschland
erforderliche
Vertragsgesetz
ist vom
Bundestag am
14. Juni
2007
angenommen
worden. Ein
Entwurf für
das in
Frankreich
erforderliche
Vertragsgesetz
wurde der
Assemblée
Nationale am
29. August
2007
vorgelegt.
Deutscher
Bundestag,
Drucksache
398/07 ;
Assemblée
Nationale,
Gesetzesentwurf
Nr. 153,
29.08.2007.

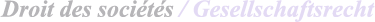
 Gütliche
Teilung
eines
liquidierten
Unternehmens
Gütliche
Teilung
eines
liquidierten
Unternehmens
Vorschriften
über
Nachlassverteilung,
einschließlich
bevorzugter
Zuteilung,
sind auf
Aufteilungen
zwischen
Gesellschaftern
anwendbar.
Diese können
regelmäßig,
durch
Fassung
einer
Satzung,
eine Verfügung
oder ein
gesondertes
Rechtsgeschäft
entscheiden,
dass gewisse
Vermögenswerte
bestimmten
Gesellschaftern
zugeteilt
werden
sollen (Code
civil [Französisches
Bürgerliches
Gesetzbuch]
Art. 1844-9,
Abs. 2 und
3).
Der
Kassationshof
hat
entschieden,
dass die gütliche
Auseinandersetzung
das
gegenseitige
Einverständnis
der
Gesellschafter
bedarf. Mit
dieser Begründung
hat das
Gericht das
Urteil eines
Berufungsgerichts
aufgehoben,
das
Gesellschaftern
einer
Gesellschaft
bürgerlichen
Rechts
erlaubte,
bei
Abwesenheit
eines
Teilhabers
mittels der
in der
Satzung
bestimmten
Dreiviertelmehrheit
über die
Aufteilung
des
Gesellschaftsvermögens
zu
entscheiden.
Auch,
wenn dies
nicht ausdrücklich
in Art.
1844-9 Code
civil
vorgeschrieben,
ist der
Grundsatz
der
Einstimmigkeit
anzuwenden,
wenn es sich
bei der
Verteilung
gewisser
Vermögenswerte
an bestimmte
Gesellschafter
um einen
Teilungsvorgang
handelt, der
der
Zustimmung
aller
Teilhaber
bedarf.
Zwar
bezieht sich
das Urteil
auf eine
Gesellschaft
bürgerlichen
Rechts, ist
aber auf
Handelsgesellschaften
übertragbar.
Kassationshof,
Kammer für
Handelsachen,
30. Mai
2007,
n°
05-13.851 (n°
800 FS-PB)
 Anwendung
der
Eigenkapitalersatzregeln
auf
Finanzierungshilfen
bei
mittelbar
verbundenen
Unternehmen Anwendung
der
Eigenkapitalersatzregeln
auf
Finanzierungshilfen
bei
mittelbar
verbundenen
Unternehmen
Das
OLG
Karlsruhe
hat in einem
Urteil vom
17. April
2007
entschieden,
dass
Finanzierungshilfen
durch ein
mit einem
Gesellschafter
verbundenen
Unternehmen
bereits dann
den
Eigenkapitalersatzregeln
gem. § 32 a
Abs. 3 GmbHG
unterliegen,
wenn das
kreditgebende
Unternehmen
im Zeitpunkt
der
Finanzierungsentscheidung
mittelbar über
das
Schwester-
oder
Mutterunternehmen
an der
Kreditnehmerin
beteiligt
ist.
Das
heißt, dass
nicht nur
von formalen
Gesellschaftern
zur Verfügung
gestelltes
funktionales
Eigenkapital
in
Eigenkapitalersatz
umqualifiziert
und dadurch
besonderen Rückzahlungsregeln
unterworfen
wird,
sondern dass
dies gemäß
§ 32 a Abs.
3 Satz 1
GmbHG auch für
andere (juristische)
Personen
gilt, wenn
diese
Gesellschaftern
wirtschaftlich
gleichstehen.
Eine solche
wirtschaftliche
Gleichstellung
wird vor
allem dann
bejaht, wenn
dem Dritten
eine
Finanzierungsverantwortung
zukommt.
Dies ist bei
Dritten, die
mit dem
Gesellschafter
eine
wirtschaftliche
Einheit
bilden, nach
der
Rechtsprechung
des BGH
insbesondere
dann gegeben,
wenn
zwischen dem
Dritten und
dem
Gesellschafter
oder der
Gesellschaft
eine
Verbindung
im Sinne der
§§ 15 ff.
AktG besteht.
Die
Rechtsprechung
entschied
bisher
regelmäßig
Fallkonstellationen,
in denen es
sich bei der
kreditgebenden
Gesellschaft
um eine GmbH
handelte,
die zwar
nicht selbst
an der
Kreditnehmerin
beteiligt
war, aber
mehrheitlich
von einem
Unternehmen
gehalten
wurde, das
an der
Kreditnehmerin
relevant
beteiligt
war. Die
Rechtsprechung
ging dabei
davon aus,
dass die für
die
Zurechnung
des
Darlehens
des
Nichtgesellschafters
an den
Gesellschafter
erforderliche
qualifizierte
Einflussmöglichkeit
des
Gesellschafters
auf die
konkrete
Finanzierungsentscheidung
zu bejahen
ist.
Vom
BGH bislang
offen
gelassen ist
die Frage,
ob ein
gesellschaftliches
Abhängigkeitsverhältnis
auch
zwischen
Aktiengesellschaften
angenommen
werden kann.
Das
OLG
Karlsruhe
hatte nun
einen
Sachverhalt
zu
entscheiden,
in dem die
kreditgebende
Aktiengesellschaft
mit der
Gesellschafterin
(ebenfalls
eine
Aktiengesellschaft)
der
kreditnehmenden
GmbH
mittelbar über
die
herrschende
Mutteraktiengesellschaft
verknüpft
war und
bejahte eine
diesbezügliche
Finanzierungsverantwortung
der
Kreditgeberin.
Dabei hielt
die
Muttergesellschaft
86,1 % und
99,77 % der
Anteile an
ihren
Tochtergesellschaften.
Das Gericht
betonte in
seiner
Entscheidung,
dass es
hinsichtlich
der
Verantwortung
für eine
ordnungsgemäße
Unternehmensfinanzierung
nicht auf
die
rechtstechnische
Ausgestaltung
der
Verbindung
zwischen den
Unternehmen
ankomme. Ob
eine dritte
Kreditgeberin
sich so
behandeln
lassen müsse,
als sei sie
selbst als
Gesellschafterin
an der
Kreditnehmerin
beteiligt
und damit
Adressatin
der
Kapitalersatzregeln,
sei in einer
wirtschaftlichen
Betrachtung
danach zu
beurteilen,
ob das
kreditgebende
Unternehmen
im
kritischen
Zeitpunkt
der
Finanzierungsentscheidung
bereits mit
Risikokapital
mittelbar (über
ein
verbundenes
Unternehmen)
an der
Kreditnehmerin
beteiligt
sei. In
einem
solchen Fall
werde
vermutet,
dass das
Darlehen mit
Rücksicht
auf die
Beteiligung
des
verbundenen
Unternehmens,
societas
causa,
gegeben
wurde.
(OLG
Karlsruhe,
Urteil vom
17. April
2007, Az.:
17 U 219/05)

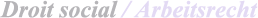
 Pflicht
des
Arbeitgebers
den
Arbeitnehmern
eine
französische
Ausführung
der
Unterlagen
zur Verfügung
zu
stellen
Pflicht
des
Arbeitgebers
den
Arbeitnehmern
eine
französische
Ausführung
der
Unterlagen
zur Verfügung
zu
stellen
Das
französische
Gesetzt «Toubon »
verpflichtet
den
Arbeitgeber,
hinsichtlich
Informationen,
die für die
Arbeitnehmer
bestimmt
sind, sich
in französischer
Sprache
auszudrücken
(Artikel
L 122-39-1
franz.
Arbeitsgesetzbuch).
Das
Ministerium
hat, auf der
Grundlage
dieses
Artikels,
hinsichtlich
eines
Arbeitnehmers
einer französischen
Tochtergesellschaft
einer ausländischen
Firmengruppe,
an das Recht
des
Arbeitnehmers
erinnert,
sich von
seinem
Arbeitgeber
eine französische
Ausführung
aller
Unterlagen
aushändigen
zu lassen,
die
insbesondere
die
Berufsausbildung,
die Hygiene
und die
Sicherheit
am
Arbeitsplatz
betreffen.
Antwort
des franz.
Ministeriums
für die
Anstellung,
die Arbeit
und
die
berufliche
Eingliederung
der
Jugendlichen
vom 5. April
2007,
Frage
Senator
Masson vom
19. Oktober
2006.
 Erlass
vom 19 April
2007 zur
Anwendung
des Gesetz n°2006-340
vom 23. März
2006 über
die
Lohngleichheit
zwischen Männern
und Frauen
Erlass
vom 19 April
2007 zur
Anwendung
des Gesetz n°2006-340
vom 23. März
2006 über
die
Lohngleichheit
zwischen Männern
und Frauen
Durch
gemeinsamen
Erlass
verschiedener
staatlichen
Stellen (der
SDFE, DGT
und DGEFP)
in Form von
Verordnungsblättern
erfolgte
eine
Konkretisierung
der
Anwendung
des Gesetzes
über die
Lohngleichheit.
Blatt
1 –
Verpflichtung,
jährlich über
den Abbau
von Vergütungsunterschieden
zwischen
Frauen und Männern
auf Basis
eines
Vergleichsberichts
zu
verhandeln.
Blatt
2 –
Staatliche
finanzielle
Unterstützung
zur Förderung
von
Gleichberechtigung
im Beruf
zwischen
Frauen und Männern.
Blatt
3 –
Verbesserung
der mit der
„Elternschaft“
verbundenen
Rechte
-
Verschärfung
von
Sanktionen
wegen
Diskriminierungen
auf
Grund
von
Schwangerschaft:
Durch
das Gesetz
vom 23. März
2006 wurden
in die
Artikel
L.122-45 und
L.123-1 des
Code du
travail
Regelungen
bezüglich
der
Diskriminierung
auf Grund
von
Schwangerschaft
eingefügt.
Das
Gesetz schützt
neben
Angestellten
auch
Bewerber auf
einen
Arbeits-
oder
Praktikumsplatz.
Für
Diskriminierungen
auf Grund
von
Schwangerschaft
sieht der
Code pénal
nunmehr eine
Geldstrafe
von bis zu
45 000
€ oder
eine
Haftstrafe
von bis zu
drei Jahren
vor (Art.
225-1 und
225-2 Code pénal).
-
Verpflichtung
zur Einführung
von
Lohnnachzahlungen
in Folge
von
Mutterschafts-
oder
Adoptionsurlaub.
Der
oder die aus
dem
Mutterschafts-
oder
Adoptionsurlaub
zurückgekehrte
Angestellte
hat Anspruch
auf eine
Anpassung
seines/ihres
Gehalts an
die während
des Urlaubs
eingetretene
allgemeine
Gehaltssteigerung
sowie die in
diesem
Zeitraum von
Angestellten
gleicher
Berufskategorie
erzielte
durchschnittliche
individuelle
Gehaltserhöhung
(Art.
L.122-26
Code du
travail).
Zu
welchem
Zeitpunkt
muss die
Lohnnachzahlung
erfolgen?
Die
Lohnnachzahlung
an dem Tag fällig,
an dem die
Person aus
ihrem
Mutterschafts-
oder
Adoptionsurlaub
zurückkehrt.
Es
sind
allerdings
nur Lohnerhöhungen
betroffen,
die während
eines
Mutterschafts-
oder
Adoptionsurlaubs
durchgeführt
wurden. Für
den
Erziehungsurlaub
ist eine
entsprechende
Regelung
nicht
getroffen
worden.
Wen
betrifft die
Regelung?
Die
Regelung des
Gesetzgebers
umfasst das
Unternehmen,
nicht aber
die Gruppe,
Wirtschafts-,
Firmeneinheit
oder Anstalt.
Welche
Löhne
betrifft die
Regelung?
Zum
Lohn im
Sinne der
Regelung zählt
das
Grundgehalt
sowie Sach-
und
Geldleistungen
und jeder
andere
Bestandteil
unmittelbarer
oder
mittelbarer
Bezahlung
von
Arbeitsleistungen
des
Angestellten
durch den
Arbeitgeber
(Gewinnbeteiligungen
werden von
der Regelung
dagegen
nicht als
Lohn
angesehen).
Ausgeschlossen
von der
Berechnungsgrundlage
sind Lohnerhöhungen
auf Grund
von Beförderung;
Prämien für
besondere
Arbeitsleistungen,
an denen der
zurückkehrende
Angestellte
nicht
mitgewirkt
hat; sowie
besondere
Zulagen (Hochzeit,
Dienstjahre…).
Sofern
Beschäftigte
derselben
Gehaltskategorie
keine
Lohnerhöhung
erhielten,
ist dies bei
der
Berechnung
der
durchschnittlichen
Gehaltsteigerung
zu berücksichtigen.
-
Verlängerung
des
Mutterschaftsurlaubs
im Falle
einer Frühgeburt
-
Rechte
auf
bezahlten
Urlaub
Gesetz
Nr. 2006-340
vom 23.
März 2006
 Schriftlicher
Geschäftsführeranstellungsvertrag
beendet
bislang
bestehenden
Arbeitsvertrag
Schriftlicher
Geschäftsführeranstellungsvertrag
beendet
bislang
bestehenden
Arbeitsvertrag
Durch
Urteil vom
19. Juli
2007 hat das
Bundesarbeitsgericht
die
bisherige
Rechtsprechung
zum
Verhältnis
zwischen
Arbeitsvertrag
und
Geschäftsführeranstellungsvertrag
bestätigt.Schließt
ein
Arbeitnehmer
mit dem
Unternehmen,
in dem er
beschäftigt
ist, einen
schriftlichen
Geschäftsführerdienstvertrag,
liegt darin
eine
einvernehmliche
Beendigung
des
bestehenden
Arbeitsverhältnisses.
Wird dem
Geschäftsführer
später
gekündigt,
kann er sich
demnach
nicht auf
sein
vorangegangenes
Arbeitsverhältnis
berufen. Er
verliert
somit den
rechtlichen
Schutz aus
dem
bisherigen
Arbeitsverhältnis,
insbesondere
den
arbeitsrechtlichen
Kündigungsschutz.Durch
den
Abschluss
des
Geschäftsführeranstellungsvertrages
stellen die
Parteien ihr
Vertragsverhältnis
auf eine
neue
vertragliche
Grundlage
und ersetzen
den
bisherigen
Arbeitsvertrag
durch den
Geschäftsführervertrag.
Allerdings
ist dem
Schriftformerfordernis
des § 623
BGB, der
für die
Aufhebung
eines
Arbeitsverhältnisses
die
Schriftform
voraussetzt,
nur im Falle
eines
schriftlichen
Geschäftsführeranstellungsvertrages
Genüge
getan.
Schließen
die Parteien
dagegen
lediglich
einen
mündlichen
Geschäftsführerdienstvertrag,
erfolgt
dadurch die
Aufhebung
des
Arbeitsverhältnisses
nicht in der
von § 623
BGB
geforderten
schriftlichen
Form.
Folglich
ruht in
diesem Falle
das
Arbeitsverhältnis
nur und kann
später, im
Falle der
Beendigung
des der
Geschäftsführerbestellung
zugrunde
liegenden
Dienstverhältnisses,
wieder
aufleben.
BAG
vom 19. Juli
2007,
Pressemitteilung
Nr. 56/07


 Forderungsanmeldung
im Fall
einer
Aufhebung
der Präklusion
Forderungsanmeldung
im Fall
einer
Aufhebung
der Präklusion
Der
Gläubiger,
der seine
Forderung
nicht
fristgemäss
angemeldet
hat, wird
nicht zur
Insolvenztabelle
zugelassen.
Dies gilt
nur dann
nicht, wenn
der Gläubiger
vom
Insolvenzrichter
eine
Aufhebung
der Präklusion
bzw. des
Rechtsausschlusses
erwirken
konnte, und
zwar
aufgrund der
Tatsache,
dass die
Fristversäumnis
ihm nicht
zugerechnet
werden kann
(Artikel L.
622-26
Handelsgesetzbuch).
Der Antrag
auf
Aufhebung
der Präklusion
muss bei
Insolvenzverfahren,
die nach dem
1. Januar
2006 eröffnet
wurden,
innerhalb
von sechs
Monaten nach
Veröffentlichung
des Eröffnungsbeschlusses
gestellt
werden. Bei
Insolvenzverfahren,
die vor dem
1. Januar
2006 eröffnet
wurden, beträgt
die Frist
ein Jahr.
Insofern
gilt zu
beachten,
dass zwar
kein
Gesetzestext
den säumigen
Gläubiger
zwingt,
seine
Forderungsanmeldung
vor der
Anrufung des
Insolvenzrichters
auf
Aufhebung
der Präklusion
nachzuholen,
so ist
dennoch
erforderlich,
dass er
seine
Forderungsanmeldung
innerhalb
eines Jahres
nach Eröffnungsbeschluss
nachholt,
und zwar
selbst dann,
wenn der
Insolvenzrichter
noch nicht
über die
Aufhebung
der Präklusion
entschieden
haben sollte
(Entscheidung
noch nach
altem Recht
für
Insolvenzverfahren,
die vor dem
1. Januar
2006 eröffnet
wurden; die
Entscheidung
ist aber auf
Insolvenzverfahren,
die nach dem
1. Januar
2006 eröffnet
wurden, übertragbar,
wobei eine
6-Monatsfrist
zu berücksichtigen
wäre).
Kassationsgerichtshof,
Senat für
Handelssachen,
9. Mai 2007,
Société
Ets coquelle
./. Receveur
divisionnaire
des impôts
d’Arras
ouest.
|