|
>
Steuerrecht
>
Gesellschaftsrecht
>
Arbeitsrecht
>
Wettbewerbsrecht

 Europarecht
Europarecht
 Deutsches
Recht
Deutsches
Recht
 Französisches
Recht
Französisches
Recht

 Veräußerungssteuer
Übertragung
von
Gesellschaftsanteilen
-
Vereinbarung
über
Gewinnaufteilung
Veräußerungssteuer
Übertragung
von
Gesellschaftsanteilen
-
Vereinbarung
über
Gewinnaufteilung
Laut
einem am 28.
November
2006 gefällten
Urteil hat
der frz.
Kassationsgerichtshof
erneut den
Grundsatz
bestätigt,
dass nur die
Gesellschafterversammlung
darüber
entscheiden
kann, ob der
im, Laufe
des Geschäftsjahres
erzielte
Gewinn oder
ein Teil
davon als
Dividende
ausgeschüttet
wird und
somit den
Dividenden
ihren
rechtlichen
Bestand
verleiht.
Folglich
besteht ein
Anspruch auf
Auszahlung
von
Dividenden
nur für die
Personen,
die am
Beschlusstag
Gesellschafter
sind.
Im
Falle einer
Übertragung
von
Gesellschaftsanteilen
während des
Geschäftsjahres,
hat der
Gerichtshof
entschieden,
dass die
vorweggenommene
Aufteilung
von
Gewinnanteilen
des
laufenden
Geschäftsjahres,
bevor diese
als solche
festgestellt
wurden, und
bevor ein
Dividendenauszahlungsbeschluss
gefasst
wurde, nicht
als
Gewinnausschüttung
verstanden
werden kann.
Eine
Vereinbarung
über die
Gewinnaufteilung
begründet für
den Erwerber
dementsprechend
eine
Verpflichtung,
die jedoch
nicht aus
dem
Gesellschaftsrecht
resultiert,
sondern die
Teil der
wirtschaftlichen
Bewertung
der übertragenen
Rechte ist.
Sie stellt
insofern
einen
Bestandteil
des
Verkaufspreises
dar, der in
die
Bemessungsgrundlage
der
Eintragungskosten
eingestellt
werden muss.
 Das
„Gesetz über
steuerliche
Begleitmaßnahmen
zur Einführung
der Europäischen
Gesellschaft
und zur Änderung
weiterer
steuerrechtlicher
Vorschriften"
(SEStEG) Das
„Gesetz über
steuerliche
Begleitmaßnahmen
zur Einführung
der Europäischen
Gesellschaft
und zur Änderung
weiterer
steuerrechtlicher
Vorschriften"
(SEStEG)
Ende
letzten
Jahres
wurden mit
dem SEStEG
grenzüberschreitende
Umstrukturierungen
von
Unternehmen
innerhalb
der EU
steuerneutral
ermöglicht
und
nationale
Steuervorschriften
geändert.
Zu diesem
Zweck
erfolgt künftig,
entgegen der
bisherigen
Praxis, bei
grenzüberschreitenden
Umstrukturierungen
innerhalb
der EU eine
Besteuerung
der stillen
Reserven nur
noch dann,
wenn das
deutsche
Besteuerungsrecht
verloren
geht. Dies
ist
insbesondere
bei der
Verbringung
von
Wirtschaftsgütern
über die
Grenze oder
bei dem
Wegzug der
Anteilseigner
an einer
Kapitalgesellschaft
der Fall.
Darüber
hinaus soll
bei grenzüberschreitenden
Umwandlungsvorgängen
der
Grundsatz
der Maßgeblichkeit
der
Handelsbilanz
für die
Steuerbilanz
nicht mehr
gelten, so
dass in
diesem Fall
ein
Wirtschaftsgut,
unabhängig
von der
handelsrechtlichen
Beurteilung,
steuerlich
immer mit
dem gemeinen
Wert
angesetzt
wird.
Eine
weitere
wichtige Änderung,
die
Auswirkungen
auch auf
rein
nationale
Besteuerungsvorgänge
hat,
betrifft die
noch
vorhandenen
Körperschaftsteuerguthaben.
Hierbei
handelt es
sich um
Guthaben,
die noch aus
der Zeit des
Anrechnungsverfahrens
stammen.
Dieses bis
2002
anzuwendende
Verfahren
sah eine
Anrechnung
der von der
ausschüttenden
Kapitalgesellschaft
gezahlten Körperschaft
auf die beim
Ausschüttungsempfänger
zu zahlende
Einkommensteuer
vor. Seit
2003 ist
dagegen nur
noch das
Halbeinkünfteverfahren
anwendbar,
wonach eine
solche
Anrechnung
nicht mehr
stattfindet,
sondern
stattdessen
die Hälfte
der
erhaltenen
Dividenden
steuerfrei
ist. Die im
Rahmen des
Übergangs
des
Anrechnungsverfahrens
auf das
Halbeinkünfteverfahren
noch
vorhandenen
Körperschaftsteuerguthaben
werden ab
2008 bis
2017 in
zehn
gleichen
Jahresbeträgen
zurückgezahlt.

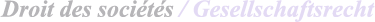
 Vergütung
des Geschäftsführers
einer SARL Vergütung
des Geschäftsführers
einer SARL
Die
Satzung
einer
Gesellschaft
mit beschränkter
Haftung
französischen
Rechts
(SARL) hatte
vorgesehen,
dass die
Vergütung
des Geschäftsführers
durch
ordentlichen
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
festgelegt
wird. Im
Rahmen einer
Gesellschafterversammlung,
bei der der
Geschäftsführer
abberufen
wurde,
stellten die
Gesellschafter
fest, dass
der Geschäftsführer
für das
abgelaufene
Geschäftsjahr
keine Vergütung
erhalten
hatte, und
beschlossen,
dass ihm
auch für
das laufende
Geschäftsjahr
keine Vergütung
gewährt
werden soll.
Der Geschäftsführer
verklagte
daraufhin
die
Gesellschaft
vor den
Gerichten
auf Zahlung
seiner Vergütung.
Das
Berufungsgericht
von Amiens
gab der
Klage des
Geschäftsführers
statt und
stellte fest,
dass bei
Fehlen
jeglicher
Gesellschafterbeschlüsse
über die
Festlegung
der von der
Satzung
vorgesehenen
Vergütung
des Geschäftsführers
diese von
den
Gerichten
festgesetzt
werden könne.
Diese
Entscheidung
wurde vom
Revisionsgericht
(Kassationsgericht)
in der
Grundlage
dahingehend
entkräftet,
dass der
Geschäftsführer,
entsprechend
der Satzung
der
Gesellschaft,
einen
Gesellschafterbeschluss
über die
Festsetzung
seiner Vergütung
herbeiführen
müsse.
Infolgedessen
könne
dieser, wenn
jeglicher
Beschluss über
die Geschäftsführervergütung
fehle, vom
Gericht
nicht die
Festlegung
seiner Vergütung
verlangen,
ohne zuvor
einen
Gesellschafterbeschluss
beantragt zu
haben.
Kassationsgericht,
Kammer für
Handelssachen,
14. November
2006, n°1244
F-PB (Société
Ste
Corneille
c/
Delattre)

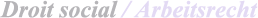
 Verpflichtung
des
Unternehmenschefs
im
Bereich
der
Sicherheit
und der
Vorbeugung
von
Gefahren
am
Arbeitsplatz
Verpflichtung
des
Unternehmenschefs
im
Bereich
der
Sicherheit
und der
Vorbeugung
von
Gefahren
am
Arbeitsplatz
Wir
möchten Sie
über die
Verpflichtung
des
Arbeitgebers
informieren,
die Gefahren
am
Arbeitsplatz
zu erfassen
und diesen
Gefahren
vorzubeugen,
um für die
Sicherheit
der
Arbeitnehmer
am
Arbeitsplatz
zu sorgen
und deren
Gesundheit
zu schützen
(Art. L.
230-2 des
frz.
Arbeitsgesetzbuches).
Es gibt in
einem
Unternehmen
viele mögliche
Gefahrenquellen
(z. Bsp.:
Fallgefahr,
Lärmbelästigung,
falsche
Beleuchtung,
Gefahren
durch die
Bildschirmarbeit,
…).
In
einer
Verordnung
des frz.
Arbeitsgesetzbuches
(Art. R.
230-1) sind
die
Einzelheiten
über die
Erfassung
dieser
Gefahren
aufgeführt.
Die
Ergebnisse
der
Erfassung
der Gefahren
für die
Sicherheit
und die
Gesundheit
der
Arbeitnehmer
eines
Unternehmens
sind in dem
so genannten
„document
unique“
darzustellen.
Diese
Erfassung
der Gefahren
dient als
Grundlage für
die Durchführung
von
vorbeugenden
Maßnahmen.
Der
Arbeitgeber
ist für
dieses
„document
unique“
verantwortlich,
selbst wenn
die
Erstellung
des
Dokuments
einem
Sicherheitsbeauftragten
oder einer
anderen
internen
oder
externen
Person des
Unternehmens
anvertraut
worden ist.
Die
Tatsache,
die
Ergebnisse
der
Erfassung
der Gefahren
nicht in dem
„document
unique“
aufzuführen
oder dieses
nicht regelmäßig
zu
aktualisieren,
stellt eine
Ordnungswidrigkeit
5. Klasse
dar, welche
mit einem Bußgeld
von bis zu
1.500 €
strafbewehrt
ist.
Es
muss daher
zunächst
eine
konkrete
Erfassung
der Gefahren
für jede
Arbeitseinheit
(Gefahrenidentifizierung
und
Gefahrenanalyse)
erfolgen,
bevor
konkret das
„document
unique“
erstellt
wird.
Das
„document
unique“
muss
zumindest
die
Ergebnisse
dieser
Analyse
enthalten.
In dieser
Form genügt
das Dokument
den
verordnungsrechtlichen
Anforderungen.
Aber
das Dokument
kann außerdem
eine Auswahl
der Gefahren
enthalten,
welche
aufgrund der
möglichen
schwerwiegenden
Konsequenzen
vorrangig
behandelt
werden. Für
jede
identifizierte
Gefahr
bestimmt der
Arbeitgeber
die
geeignete
Vorbeugemaßnahme.
Wir
stehen Ihnen
für weitere
Auskünfte
und Ausführungen
zur Verfügung,
insbesondere
im
Zusammenhang
mit der
Identifikation
der Gefahren
in Ihrem
Unternehmen
und der
Erstellung
eines„document
unique“ in
Ihrem
Unternehmen.
 Betriebsübergang:
Kündigungsschutz
geht nicht
auf den
Erwerber über
Betriebsübergang:
Kündigungsschutz
geht nicht
auf den
Erwerber über
Das
Bundesarbeitsgericht
hatte am 15.
Februar 2007
darüber zu
entscheiden,
ob der bei
dem
Betriebsveräußerer
erworbene Kündigungsschutz
im Falle des
Betriebsübergangs
auf den
Erwerber übergeht.
Im
Falle eines
Betriebsübergangs
nach §
613 a
BGB tritt
der Erwerber
grundsätzlich
in alle
Rechte und
Pflichten
der übergehenden
Arbeitsverhältnisse
ein. In
dieser
Entscheidung,
die bislang
nur als
Pressemitteilung
vorliegt,
stellt das
Bundesarbeitsgericht
klar, dass
bei einem
Betriebsübergang
der beim Veräußerer
aufgrund der
Beschäftigtenzahlen
nach § 23
KSchG
erworbene Kündigungsschutz
nicht zu den
übergangsfähigen
Rechten gehört.
Die
Klägerin
hatte beim
Veräußerer
aufgrund
ihrer langjährigen
Betriebszugehörigkeit
und der Größe
des
Betriebes Kündigungsschutz
nach dem Kündigungsschutzgesetz
erworben.
Der Erwerber
fiel als
Kleinbetrieb
nicht unter
das Kündigungsschutzgesetz
und kündigte
der Klägerin,
nachdem die
einjährige
Sperrfrist
nach dem
Betriebsübergang
abgelaufen
war. Mit
ihrer Klage
wollte die
Klägerin
die
Unwirksamkeit
der Kündigung
festgestellt
wissen und
vertrat die
Ansicht, das
Kündigungsschutzgesetz
finde
Anwendung.
Nachdem die
Klage schon
in allen
Vorinstanzen
erfolglos
geblieben
war, wies
das
Bundesarbeitsgericht
die Revision
zurück, da
in dem
Betrieb des
Erwerbers
die Beschäftigtenzahlen
des § 23
KSchG nicht
vorlagen.
BAG
15. Februar
2007,
Pressemitteilung
15/07
 Unwirksamkeit
einer „im
Auftrag“
unterschriebenen
Kündigung
Unwirksamkeit
einer „im
Auftrag“
unterschriebenen
Kündigung
Das
Arbeitsgericht
Hamburg
hatte
kürzlich über
die
Wirksamkeit
einer von
einem
Assistenten
der Geschäftsführung
mit dem
Zusatz „i.A.“
unterschriebenen
Kündigung
zu befinden.
Nach
§ 623 BGB
muss die Kündigung
eines
Arbeitsverhältnisses
schriftlich
erfolgen.
Die Urkunde
muss dabei
von ihrem
Aussteller
eigenhändig
unterzeichnet
werden.
Nach
Ansicht des
Gerichts war
dies bei der
„im
Auftrag“
unterschriebenen
Kündigung
nicht der
Fall. Der
Zusatz „i.A.“
sei vielmehr
im Gegensatz
zu dem
Zusatz „i.V.“
zu sehen. Während
letzterer
auf ein
Vertretungsverhältnis
hindeute,
verdeutliche
der Zusatz
„i.A.“ ,
dass es sich
bei dem
Unterzeichner
lediglich um
einen Boten
handele. Im
Unterschied
zu dem
Vertreter gäbe
der Bote
jedoch keine
eigene
Willenserklärung
in eigener
Verantwortung
ab, sondern
übermittle
lediglich
Willenserklärungen
eines
anderen. Er
sei somit
rechtlich
nicht als
Aussteller
der Urkunde
anzusehen
und könne
daher durch
seine
Unterschrift
die
Schriftform
nicht erfüllen.
Aufgrund der
somit
vorliegenden
Formunwirksamkeit
der Erklärung
stellte das
Gericht die
Unwirksamkeit
der
ausgesprochenen
Kündigung
fest.
Für
die Praxis
hat diese
Entscheidung
die
Konsequenz,
dass bei
einer durch
einen
Dritten
unterschriebenen
Kündigungserklärung
die
Vertreterstellung
des
Unterzeichners
deutlich zu
kennzeichnen
ist. Dabei
ist auch
daran zu
denken, der
Kündigung
eine
entsprechende
Vollmacht
beizulegen,
da sie
andernfalls
nach §174
BGB zurückgewiesen
werden kann.
ArbG
Hamburg, 08.
Dezember
2006, 27 Ca
21/06 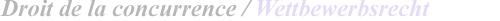
 Verbot
des
Weiterverkaufs
unter
Einkaufspreis
Verbot
des
Weiterverkaufs
unter
Einkaufspreis
Im
französischen
Recht ist
der
Weiterverkauf
unter
Einkaufspreis
durch Art.
L. 442-2
Handelsgesetzbuch
verboten.
Diese
Bestimmung
im
Handelsgesetzbuch
macht dabei
keinerlei
Unterschied
zwischen den
Akteuren und
inkriminiert
jeden
Kaufmann,
der eine
Ware unter
Einkaufspreis
weiterverkauft.
In diesem
Sinne hat
der
Kassationsgerichtshof
kürzlich
die
Verurteilung
einer
Vertriebsgesellschaft,
die
Sportartikel
vertreibt,
bestätigt.
Die
betroffene
Gesellschaft
hatte
Sportartikel,
die sie
vorher bei
einer 100%-igen
Tochtergesellschaft
erworben
hatte, unter
Einkaufspreis
weiterverkauft.
Insofern
gilt zu
beachten,
dass
diejenigen
Ausnahmeregeln,
wonach an
sich unzulässige
Absprachen
bei Tätigkeiten
zwischen
Unternehmen
einer
Unternehmensgruppe
zulässig
sein können,
keine
Anwendung im
Bereich des
Verbots des
Weiterverkaufs
unter
Einkaufspreis
finden.
|