| |
>
Steuerrecht
>
Insolvenzrecht
>
Arbeitsrecht
>
Verschiedenes

 Europarecht
Europarecht
 Deutsches
Recht
Deutsches
Recht
 Französisches
Recht
Französisches
Recht

 Verrechnungspreise
:
Information
und
Sicherstellung
für
kleine und
mittelständige
Unternehmen (KMU)
Verrechnungspreise
:
Information
und
Sicherstellung
für
kleine und
mittelständige
Unternehmen (KMU)
Jedes
Unternehmen,
das grenzüberschreitenden
Transaktionen
(Kauf und
Verkauf von
Waren und
Dienstleistungen,
Marken- und
Patentübertragung
oder
Konzession…)
mit
Unternehmen
ausführt,
welche von
ihm abhängig
sind, das
heißt
Unternehmen,
die von ihm
tatsächlich
oder
rechtlich
kontrolliert
werden, oder
die das
Unternehmen
kontrollieren;
muss sich
vergewissern,
dass seine
Verrechnungspreise
richtig
aufgewertet
sind.
Allerdings
stellen die
von der
Organisation
für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und
Entwicklung
(OECD)
erlassenen
Empfehlungen
(57 des
„Code Général
des Impôts“
(Abgabenordnung
und
Textsammlung
der
Steuergesetze)
den
Grundsatz
auf, dass
die zwischen
gebundenen
Unternehmen
vorgenommenen
Geschäfte
dem Prinzip
des vollen
Wettbewerbs (?)
entsprechend
ausgeführt
werden müssen,
das heißt,
das diese
Geschäfte
unter
denselben
Bedingungen
ausgeführt
werden müssen
wie
identische
Geschäfte
zwischen
unabhängigen
Unternehmen.
Die
Ermittlung
des
Fremdvergleichspreises
(des vollen
Wettbewerbspreises)
kann sich für
die kleinen
und mittelständigen
Unternehmen
(KMU) als
schwierig
herausstellen.
In diesem
Zusammenhang
informiert
die
Verwaltung
die KMU in
einer von
ihr veröffentlichten
Ermittlung
über
folgende Maßnahmen:
-
die
Möglichkeit
zur Einsicht
in das
online erhältliche
Praxis-Handbuch
„Die
Verrechnungspreise“
auf der
Webseite impôt.gouv.fr.
-
die
Möglichkeit
eines
vereinfachten
Verfahrens
bezüglich
der
vorherigen
zweiseitigen
Zustimmung
im
Verrechnungspreisbereich,
was
insbesondere
darin
besteht, die
erforderte
Dokumentation
zur Stellung
und
Ermittlung
des
Zustimmungsantrages
zu
erleichtern.
Instr.
28 .
November
2006, BOI 4
A-13-06
 Umsatzsteuererhöhung
zum 1.
Januar 2007
Umsatzsteuererhöhung
zum 1.
Januar 2007
Am
1. Januar
2007 tritt
in
Deutschland
die
vieldiskutierte
Umsatzsteuererhöhung
in Kraft. Während
der ermäßigte
Steuersatz
unverändert
bei 7%
liegt,
wurde der
normale
Steuersatz
von 16 auf
19% erhöht.
Dies
bedeutet,
dass für
alle ab 1.
Januar 2007
ausgeführten
Umsätze ein
normaler
Steuersatz
in Höhe von
19%
eingreift.
Der Stichtag
1. Januar
2007 gilt für
den
Zeitpunkt
der
Leistungsausführung.
Für alle
vorher
ausgeführten
Leistungen
ist der
bisherige
Steuersatz
anwendbar, für
die ab dem
1. Januar
2007 ausgeführten
Leistungen
greift
dagegen der
neue
Steuersatz
ein. Auf den
Zeitpunkt
der
Rechnungsstellung
oder gar die
Vereinnahmung
des Entgelts
kommt es
dagegen
nicht an.
Das
Abstellen
auf den
Leistungszeitpunkt
führt dazu,
dass auch
auf
Vorschussrechnungen,
die eine
Leistungserbringung
ab dem 1.
Januar 2007
betreffen,
der
Umsatzsteuersatz
von 19%
anzuwenden
ist, selbst
im Falle der
Rechnungsstellung
noch im Jahr
2006. Sofern
die
Vorschussrechnung
lediglich
eine 16%ige
Umsatzsteuer
ausweist,
sollte der
Unternehmer
unbedingt
auf eine
Nachberechnung
der
Differenz im
Rahmen der
Schlussrechnung
achten.


 Insolvenzrecht
/ Bestreiten
einer
Forderung
bei der Prüfung
durch den Gläubigervertreter:
Mitteilung
an den Gläubiger
Insolvenzrecht
/ Bestreiten
einer
Forderung
bei der Prüfung
durch den Gläubigervertreter:
Mitteilung
an den Gläubiger
Für
den Fall,
dass eine
Forderung
bestritten
wird, hat
der Gläubigervertreter
dies dem Gläubiger
mitzuteilen
und ihn
dabei
aufzufordern,
sich hierzu
zu erklären
(Art. L.
622-27 neue
Fassung
Handelsgesetzbuch).
Gemäß
Verordnung
vom
28.12.2005,
Art. 72, hat
die
Mitteilung
unter
anderem den
Gegenstand
des
Bestreitens
zu präzisieren
und darauf
hinzuweisen,
dass mangels
Antwort
innerhalb
von 30 Tagen
nach Eingang
der
Mitteilung
der Gläubiger
sein Recht
zur
Gegendarlegung
verwirkt.
Aus dieser
Vorschrift
folgt, dass
die
Mitteilung
durch den Gläubigervertreter
die Gründe
des
Bestreitens
angeben muss,
damit der Gläubiger
sich zu den
bestrittenen
Punkten erklären
kann. In
einem Fall,
in dem ein
Gläubiger
lediglich über
die Tatsache,
dass seine
Forderung
bestritten
werde und über
die Höhe
des
Bestreitens
informiert
wurde, sich
nicht
innerhalb
der
30-Tage-Frist
erklärt
hatte,
entschied
der
Kassationsgerichtshof,
dass die
Mitteilung
durch den Gläubigervertreter
unvollständig
war und
daher die
Erklärungsfrist
nicht zu
laufen
begann.
Folglich ist
die Frist,
in der der
Gläubiger
sich zu dem
Bestreiten
erklären
konnte,
nicht
verwirkt (Kassationsgerichtshof,
Kammer für
Handelssachen,
vom 27. Juni
2006,
Gesellschaft
Still ./.
Forment ès
qual.)

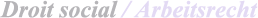
 Abänderung
des
Arbeitsvertrages
Abänderung
des
Arbeitsvertrages
Der
Arbeitgeber
muss die
einmonatige
Überlegungsfrist
einhalten,
bevor er ein
Kündigungsverfahren
nach
Weigerung
der
Abänderung
des
Arbeitsvertrages
durch einen
Arbeitnehmer
einleitet.
Im
vorliegenden
Fall hatte
eine
Arbeitnehmerin
am 20.
November
2002 den
Vorschlag
ihres
Arbeitgebers
abgelehnt,
ihre
Arbeitszeiten
zu
verändern.
Der
Vorschlag
war von dem
Arbeitgeber
am 9.
November
2002 gemacht
worden. Der
Arbeitgeber
hatte das
Kündigungsverfahren
am 26.
November
2002
eingeleitet,
als er die
Arbeitnehmerin
zu dem
Vorgespräch
vor der
Kündigung
geladen
hatte. Diese
Ladung
erfolgte
also vor
Ablauf der
einmonatigen
Überlegungsfrist.
Der
Kassationshof
(22.
November
2006,
n°05-42.619)
betont, dass
eine
Kündigung,
welche auf
der
Ablehnung
der
Abänderung
seines
Arbeitsvertrages
durch einen
Arbeitnehmer
beruht, dann
unbegründet
ist, wenn
die
einmonatige
Überlegungsfrist
von dem
Arbeitgeber
nicht
eingehalten
worden ist.
Diese
einmonatige
Überlegungsfrist
muss daher
immer
eingehalten
werden,
bevor ein
Kündigungsverfahren
eingeleitet
wird, selbst
wenn der
Arbeitnehmer
den
Vorschlag
der
Abänderung
seines
Arbeitsvertrages
bereits vor
Ablauf der
einmonatigen
Frist
abgelehnt
hat.
 Kontrolle
der Akten
und Karteien,
die von dem
Lohnempfänger
mit dem
Rechner der
Gesellschaft
geschaffen
wurden
Kontrolle
der Akten
und Karteien,
die von dem
Lohnempfänger
mit dem
Rechner der
Gesellschaft
geschaffen
wurden
Die
Akten und
Karteien,
die von dem
Lohnempfänger
dank dem
EDV-Hilfsmittel
entstehen,
das von
ihrem
Arbeitsgeber
für die
Ausführung
seiner
Arbeit zur
Verfügung
gestellt
wurde,
werden
angenommen,
einen
professionellen
Charakter zu
haben,
sobald sie
nicht als
personal
identifiziert
werden. Der
Arbeitsgeber
kann also
außerhalb
der
Anwesenheit
des
Lohnempfängers
Zugang dazu
haben. (Kassationsgerichtshof
soziales
Zimmer 18
Oktober 2006
n°
04-48025).
So
außer
Risiko oder
besonderem
Ereignis
für das
Unternehmen
kann der
Arbeitsgeber
die von dem
Lohnempfänger
als
enthaltenes
Personal
identifizierten
Karteien,
über die
Festplatte
des Rechners
nicht
öffnen, der
sie nur in
seiner
Anwesenheit
zur
Verfügung
gestellt
wurde. (Kassationsgerichtshof
soziales
Zimmer 17
Mai 2005 n°
03-40017).
Es
ist nötig
hervorzuheben,
dass diese
Rechtsprechung
nur die
Akten und
Karteien
betrifft,
die von dem
Lohnempfänger
mit dem
Rechner der
Gesellschaft
geschaffen
wurden und
nicht auf
die
elektronische
Versand
Anwendung
findet.
 Erhöhung
der
Regelaltersgrenze
für Renten
auf 67 Jahre
Erhöhung
der
Regelaltersgrenze
für Renten
auf 67 Jahre
Das
Bundeskabinett
hat am 29.
November
2006
beschlossen,
die
Regelaltersgrenze
für den
Bezug der
Altersrente
schrittweise
auf 67 Jahre
anzuheben.
Ab dem Jahr
2012 soll
das
Renteneintrittsalter
von bisher
65 Jahren
zunächst jährlich
um einen
Monat
ansteigen,
ab dem Jahr
2024 dann um
jährlich
zwei Monate,
bis es im
Jahr 2029
bei 67
Jahren liegt.
Für
Altersteilzeitvereinbarungen,
die vor dem
01. Januar
2007
geschlossen
wurden, gilt
besonderer
Vertrauensschutz.
Hier gilt
die
Regelaltersgrenze
von 65
Jahren
weiter, wenn
für
Personen,
die vor 1955
geboren
wurden, vor
dem 01.
Januar 2007
verbindlich
Altersteilzeit
vereinbart
wurde.
Weitere Änderungen
wurden auch
für andere
Rentenarten
(Witwen und
Witwer,
Schwerbehinderte,
Erwerbsminderung)
beschlossen.
Da der
Gesetzentwurf
noch von
Bundestag
und
Bundesrat
verabschiedet
werden muss,
sind noch Änderungen
denkbar.
Personalchefs
sollten
daher –
vorbehaltlich
eventueller
Änderungen
im
Gesetzgebungsverfahren
- die im
Unternehmen
verwendeten
(Muster-)Arbeitsverträge
daraufhin prüfen,
ob bei den
unbefristeten
Verträgen
eine starre
Altersgrenze
(z.B. 65
Jahre)
verwendet
wird oder
nur auf die
gesetzliche
Altersgrenze
verwiesen
wird. Knüpfen
die Verträge
die
Beendigung
des
Arbeitsverhältnisses
an das
Erreichen
eines
bestimmten
Lebensjahres
an, sollte
diese
Formulierung
durch eine
Bezugnahme
auf die „jeweilige
gesetzliche
Altersgrenze“
ersetzt
werden.
Andernfalls
besteht die
Gefahr, dass
die
ausscheidenden
Arbeitnehmer
ab dem Jahr
2012 wegen
Nichterreichens
der
Regelaltersgrenze
noch keine
Altersrente
erhalten und
mit einer
Versorgungslücke
leben müssen.
 
 Definition
der
Zahlungsunfähigkeit
eines
Unternehmens
(Berufungsgericht
Orléans
19/10/2006)
Definition
der
Zahlungsunfähigkeit
eines
Unternehmens
(Berufungsgericht
Orléans
19/10/2006)
Das
Konkursverfahren
einer
Gesellschaft
war von
einem
Handelsgericht
nach einer
Klage einer
ihrer Gläubiger
ausgesprochen
worden, dem
die
Gesellschaft
12.500 EUR
schuldete.
Das
Berufungsgericht
Orléans hat
entschieden,
dass die
Gesellschaft
tatsächlich
zahlungsunfähig
war, weil:
§
Ihr
Auftragsbuch
keine Aktiva
darstellen,
da dieses
kein verfügbares
Aktiv bildet;
§
Ihr
Sitz auf den
persönlichen
Wohnsitz
ihres
Leiters übertragen
worden war,
sodass sie
keine
Betriebsräume
mehr hatte.
Der
gerichtliche
Auktionator,
der das
Inventar der
Güter
vornehmen
sollte,
hatte daher
seine
Mission
nicht ausführen
können;
§
Ihr
Aktiv
bestand aus
43 Cents.
Im
Gegensatz
zum
Handelsgericht
ist das
Berufungsgericht
zur
Auffassung
gelangt,
dass gegen
die
Gesellschaft
ein Reorganisationsverfahren
und nicht
ein
Insolvenzverfahren
hätte eröffnet
werden
sollen, da
aufgrund von
sicheren
Aufträgen (drei
Kostenvoranschläge
mit
Bewilligungsbescheid
und
Unterschrift
der Kunden)
für einen
Betrag von
ungefähr
72.000 EUR
ein
Sanierungsprogramm
in Betracht
gekommen wäre.
Diese
Entscheidung,
in welchem
das Gericht
das Regime
anwendet, so
wie es nach
der Reform
der
kollektiven
Verfahren
von
2005 in
Kraft ist,
weist zwar
das
Auftragsbuch
als verfügbares
Aktiv ab,
berücksichtigt
dieses
Auftragsbuch
jedoch
wiederum, um
die Art des
auf den
Schuldner
anwendbaren
kollektiven
Verfahrens
zu bestimmen.
 In
Richtung
eines
europäischen
Statuts für
die kleinen
und
mittleren
Unternehmen
In
Richtung
eines
europäischen
Statuts für
die kleinen
und
mittleren
Unternehmen
Der
Ausschuß
der
Rechtsangelegenheiten
des Europäischen
Parlaments
hat der Europäischen
Kommission
am 20. November
2006
empfohlen,
ein Europäisches
Privates
Gesellschaft
(EPG)
Statut
vorzuschlagen,
um den
kleinen und
mittlere
Unternehmen
von Europa
zu helfen,
ihre Tätigkeiten
jenseits der
Grenzen
auszuüben,
nach den
detaillierten
Empfehlungen,
die dem
Bericht von
Klaus-Heiner
Lehne beigefügt
wurden.
Während
das aktuelle
Statut der
Europäischen
Gesellschaft
für die großen
und mittlere
Unternehmen
an beschränkter
Haftung
bestimmt ist,
müsste das
EPG-Statut
die Aufgabe
der kleinen
und
durchschnittlichen
Unternehmen
(KMU)
vereinfachen,
die über
ein
Mindestkapital
von 10.000
€ verfügt,
ihre
Handelstätigkeiten
außerhalb
ihres
Errichtungslandes
auszuüben,
ohne zu müssen,
in jedem
Mitgliedstaat
registriert
zu werden.
Wenn
dieses
Statut
aufkommt, hätten
die EPG sich
nur an einer
Serie von
Europäischen
Regeln anzupassen,
was erlauben
wird, ihre Kosten
für Konsultationen
und für Rechtsräte
zu reduzieren.
Die Abgeordneten
empfehlen so,
dass
das
EPG-Statut sowie
als
möglich auf
der
Gesetzgebung
der Europäischen
Union basiert
wird.
Die
Abgeordneten
haben
ebenfalls
Empfehlungen
gebilligt,
die darauf
achten, dass
die Rechte
der Arbeiter
nicht
verletzt
werden. Wenn
KMU ein EPG
werden, müssen
seine
Lohnempfänger
ihre
Informations-
und
Konsultationsrechte
beibehalten.
Der
gebilligte
Text umfaßt
auch
Bestimmungen
über die
Organisation
des EPG, die
Verantwortung
der Führungskräfte
gegenüber
der
Gesellschaft
und die
Insolvenzverfahren.
Dieser
Bericht muß
in
Vollversammlung
durch eine Mehrheit
der Mitglieder
des Europäischen
Parlamentes
entsprechend
dem Artikel
192 des
EG-Vertrags
angenommen
werden.
|
|