|
>
Steuerrecht
>
Gesellschaftsrecht
>
Arbeitsrecht
>
Verschiedenes

 Europarecht
Europarecht
 Deutsches
Recht
Deutsches
Recht
 Französisches
Recht
Französisches
Recht

 Umsatzsteuer
– ausländische
Unternehmen
–
Verlagerung
der
Steuerschuldnerschaft
II
Umsatzsteuer
– ausländische
Unternehmen
–
Verlagerung
der
Steuerschuldnerschaft
II
Im
Anschluss an
unseren
Newsletter
Nr. 2006/2
vom 28. März
2006 machen
wir darauf
aufmerksam,
dass die
neuen Regeln
zur
Steuerschuldnerumkehr
(reverse
charge)
seit dem 1.
September
2006
zwingend in
Frankreich
anzuwenden
sind.
Es
sei daran
erinnert,
dass danach
ab sofort
das Prinzip
der
Steuerschuldnerumkehr
(reverse
charge),
wie es etwa
bei sog.
immateriellen
bzw.
geistigen
Leistungen (z.B.
Anwaltshonorar)
bereits vor
dem 1.
September
2006 galt,
auf fast
alle
Bereiche von
Dienstleistungen
und
Warenlieferungen
in
Frankreich
ausgedehnt
wird. Dieses
Prinzip der
Steuerschuldnerumkehr
findet also,
sofern die
Voraussetzungen
hierzu –
d.h.
Leistung
durch nicht
in
Frankreich
ansässiges
Unternehmen
an
Unternehmen
mit französischer
Umsatzsteuer-ID-Nummer
- gegeben
sind, ab
sofort (bis
auf wenige
im Gesetz
ausdrücklich
vorgesehene
Ausnahmen)
auf alle
Dienstleistungen
und
Warenlieferungen
in
Frankreich
Anwendung.
Hiervon
betroffen
sind also
auch etwa
Lieferungsleistungen
nach Montage
und
Installation
und
Bauleistungen
an in
Frankreich
belegenen
Bauwerken.
Die
ab dem 1.
September
2006 in
Frankreich
geltende
allgemeine
Anwendung
dieses Reverse
charge-Prinzips
ergibt sich
im Übrigen
direkt aus
dem Gesetz
und ist
grundsätzlich
zwingendes
Recht. Es
gibt
allerdings
mittlerweile
gemäß
Finanzanweisung
vom 23. Juni
2006 eine
Toleranzrichtlinie
der französischen
Finanzbehörden,
wonach von
der neuen
Regelung auf
Wunsch
abgewichen
werden könnte:
Auch wenn
der
Leistungsempfänger
danach in
Frankreich
umsatzsteuerlich
registriert
sein sollte,
könnte auch
nach dem 1.
September
2006
weiterhin
der
Leistungserbringer
die frz.
Umsatzsteuer
(TVA) in
Rechnung
stellen,
wenn sich
Leistungserbringer
und
Leistungsempfänger
dahingehend
schriftlich
einigen. Der
Steuerschuldner
der frz.
Umsatzsteuer
bleibt zwar
auch bei
Anwendung
dieser
Toleranzregelung
der
Leistungsempfänger,
wie dies ja
nach der
neuen
Rechtslage
nunmehr ab
dem 1.
September
2006
vorgesehen
ist.
Lediglich
die Erklärung
und Abführung
der vom
Leistungsempfänger
geschuldeten
frz.
Umsatzsteuer
erfolgt
durch den
Leistungserbringer.
Dieser müsste
zu diesem
Zweck bei
Anwendung
der
Toleranzregelung
einen
besonderen
Fiskalvertreter
(répondant
fiscal)
bestellen,
der die
Umsatzsteuervoranmeldungen
im Namen des
Leistungserbringers
abgeben würde.
Die
Rolle des répondant
fiscal
ist im Übrigen
im
Wesentlichen
mit der
bekannten
Regelung
eines
Fiskalbeauftragten
vergleichbar.

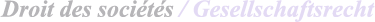
 Die
Europäische
Kommission
verabschiedet
Leitlinien
über
Risikoinvestitionen
in
kleinen
und
mittelständischen
Unternehmen
Die
Europäische
Kommission
verabschiedet
Leitlinien
über
Risikoinvestitionen
in
kleinen
und
mittelständischen
Unternehmen
Die
von der
europäischen
Kommission
verabschiedeten
Leitlinien
betreffen Maßnahmen
zugunsten
von
Kapitalinvestitionen
kleiner und
mittelständischer
Unternehmen,
die sich am
Anfang ihrer
Tätigkeit
befinden,
d.h. in der
Aufschwungs-
und
Expandierungsphase,
in der die
Finanzierung
durch öffentliche
und private
Investoren
gemeinschaftlich
erfolgt. In
dieser
Situation
stimmt die
Kommission
der Ansicht
zu, dass der
Markt
schwach ist,
bzw. dass
die Kapitalmärkte
keine
anderen
Finanzierungsalternativen
bieten. Die
neuen
Leitlinien
werden die
Zugangsbedingungen
zu
Kapitalinvestitionen
verbessern,
insbesondere
durch die
Einführung
einer
Sicherheitsgrenze
von 1,5
Millionen
EUR pro
kleinem oder
mittelständischem
Betrieb für
einen
Zeitraum von
12 Monaten.
Die
Sicherheitsgrenze
ist im
Vergleich
zur
vorhergehenden,
die aus der
vorherigen
Leitlinie
aus dem Jahr
2001 („Staatliche
Beihilfen
und
Kapitalinvestitionen“)
stammt, um
50 %
heraufgesetzt
worden.
Bei
Überschreitung
dieser
Grenze, müssen
die
Mitgliedstaaten
der
Kommission
den Nachweis
erbringen,
dass der
Markt
schwach ist.
Die
Kommission
nimmt
daraufhin
eine
eingehende
Prüfung des
Risikos
einer
Wettbewerbsverzerrung
vor. Diese
differenzierte
Art und
Weise der
Einschätzung
nach der
wirtschaftlichen
Auswirkung
bringt das
ausgereiftere
wirtschaftliche
Vorgehen zur
Anwendung,
das vom
Aktionsplan
bezüglich
der
staatlichen
Beihilfen
vorgesehen
ist.
Diese
Maßnahmen
ergänzen
andere Maßnahmen,
die
hinsichtlich
der
staatlichen
Beihilfen
ergriffen
worden sind,
wie z.B.:
- Neue
Leitlinien
hinsichtlich
regionaler
Beihilfen,
welche
die
betrieblichen
Beihilfen
zugunsten
von
kleinen
Unternehmen
in den
unterstützten
Regionen
erfassen,
um deren
Wachstum
während
der Gründungs-
und
Startzeit
zu fördern;
- Vorbereitung
einer
generellen
Ausnahme
nach
Kategorie,
welche
die
Mitgliedstaaten
von der
Bekanntgabepflicht
hinsichtlich
bestimmter
Maßnahmen
auf dem
Gebiet
der
staatlichen
Beihilfen
befreien
wird;
- Ein
Vorschriftenentwurf
bezüglich
staatlicher
Beihilfen
im
Bereich
Forschung,
Entwicklung
und
Innovation.
 Deutsche
Normen zur
Insolvenzverschleppung
sind auch
auf eine
Limited mit
Verwaltungssitz
in
Deutschland
anzuwenden
Deutsche
Normen zur
Insolvenzverschleppung
sind auch
auf eine
Limited mit
Verwaltungssitz
in
Deutschland
anzuwenden
In
einem Urteil
des
Landgerichts
Kiel vom 20.
April 2006
wird die
persönliche
Haftung des
Inhabers
einer
Limited mit
einziger
Betriebsstätte
in
Deutschland
nach § 64
Abs.1 GmbHG
bejaht. Hierbei handelt
es sich um
das erste
Urteil eines deutschen
Berufungsgerichts zum
Gläubigerschutz
gegenüber
einer Ltd.
mit
Verwaltungssitz
in
Deutschland.
Die
Anwendbarkeit
des § 64
Abs.1 GmbHG folgt
laut Gericht aus
Artikel 4
Europäische
Insolvenzverordnung,
wonach für
das
Insolvenzverfahren
und seine
Wirkungen
das
Insolvenzrecht
des
Mitgliedsstaates
gilt, in dem
das
Verfahren eröffnet
wird.
Entscheidend
war für die
Kammer des
Landgerichts
Kiel, ob die
entsprechende
Vorschrift
des § 64
Abs. 1 GmbHG
überhaupt
dem
Insolvenzrecht
zuzurechnen ist.
Dies bejahte
die Kammer
deswegen, da die
Vorschrift
dem Gläubigerschutz
durch
Fernhaltung
konkursreifer
Gesellschaften
vom
Rechtsverkehr
dient. Der
Zweck des
Verkehrsschutzes
weist laut
dem Gericht
jedoch
keinen Bezug
zum
Gesellschaftsrecht
auf. Das
Argument der
Vorinstanz,
deutsches
Gesellschaftsrecht
gelange über
die "Hintertür" der
Insolvenzverschleppung
zur
Anwendung, sei
daher zurückzuweisen,
da § 64
Abs.1 GmbHG
nicht als
gesellschaftsrechtliche
Vorschrift
anzusehen
ist.
Für
die Praxis
bedeutet das
Urteil, dass
die
Gesellschaftsform
der Ltd. den
Geschäftsführer
(Director)
im Falle
einer
Insolvenzverschleppung
nicht vor
einer persönlichen
Haftung
gegenüber
der
Gesellschaft
schützt.
Vor diesem
Hintergrund
sollte man
bei Gründung
und Betrieb
einer Ltd.
mit Sitz in
Deutschland
nicht nur
die
Leichtigkeit
der Gründung
berücksichtigen,
sondern auch
die
Anforderungen
des
deutschen
Insolvenzrechts
an die
Kapitalausstattung
des
Unternehmens.
Abschließend
sei bemerkt,
dass eine
vergleichbare
Haftung des
Directors
bei
Insolvenzverschleppung
auch nach
englischem
Recht in
Betracht
kommt und
dort unter
dem Namen
„wrongful
trading“
bekannt ist.

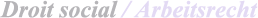
 Vereinbarkeit
von
Tariftreueklauseln
mit der
Dienstleistungsfreiheit?
Vereinbarkeit
von
Tariftreueklauseln
mit der
Dienstleistungsfreiheit?
Das
OLG Celle
hat am 17.
August 2006
dem EuGH die
Frage
vorgelegt,
ob eine
Vorschrift
europarechtswidrig
ist, wonach
öffentliche
Auftraggeber
Aufträge für
Bauleistungen
nur an
solche
Unternehmer
zu vergeben
haben, die
sich bei der
Angebotsabgabe
schriftlich
verpflichten,
ihren
Arbeitnehmern
bei der Ausführung
dieser
Leistungen
mindestens
das am Ort
der Ausführung
tarifvertraglich
vorgesehene
Entgelt zu
bezahlen.
Die
Dienstleistungsfreiheit
verlangt die
Aufhebung
aller Beschränkungen,
die geeignet
sind, die Tätigkeiten
der europäischen
Dienstleistenden
zu behindern
oder weniger
attraktiv zu
gestalten.
Die bei der
Vergabe öffentlicher
Aufträge
von
einzelnen
Bundesländern
vorgesehenen
Tariftreueklauseln
haben jedoch
zur Folge,
dass die
Bauunternehmen
anderer
Mitgliedstaaten
ihren
Wettbewerbsvorteil
dort nicht
mehr nutzen
können, da
sie
gezwungen
sind, die
ihren
Arbeitnehmern
gezahlten
geringen
Entgelte dem
regelmäßig
höheren
Niveau am
Ort der Ausführung
anzupassen.
Dies führt
zu einer
Behinderung
des
Marktzugangs
für eben
solche
Unternehmen.
Diese
Beeinträchtigung
des Marktes
könnte
gerechtfertigt
sein, wenn
sie auf
zwingenden
Gründen des
Allgemeininteresses
beruht.
Hierfür käme
vorliegend
der Schutz
der
Arbeitnehmer
in Betracht.
Jedoch ist
bereits
fraglich, ob
eine
Abschottung
der
deutschen
Bauunternehmer
vor der
Konkurrenz
aus anderen
Mitgliedstaaten
wirklich dem
Schutz der
Arbeitnehmer
dienen kann
und darüber
hinaus, ob
der mit der
Abschottung
verfolgte
wirtschaftliche
Zweck dem
Erfordernis
des
Allgemeininteresses
gerecht
werden kann.
Daher
bleibt
abzuwarten,
wie der EuGH
die
aufgeworfene
Frage
beurteilt
und welche
Folgen sich
daraus für
nationale
Bauunternehmen
ergeben.
 Psychische
Belästigung
Psychische
Belästigung
In
einem Urteil
vom 21. Juni
2006 nimmt
der französische
Kassationshof
zum ersten
Mal zur persönlichen
Haftung
eines
Arbeitnehmers
Stellung,
der ihm
untergeordnete
Angestellte
psychisch
belästigt.
Dabei bejaht
er eine
Pflicht der
Anstellungskörperschaft,
die
Sicherheit
und
Gesundheit
seiner
Angestellten
sicherzustellen.
Der
Kassationshof
nimmt nämlich
die persönliche
Haftung
eines
Arbeitnehmers
an, der ihm
untergeordnete
Arbeitnehmer
regelmäßig
und
absichtlich
psychisch
belästigt.
Der
Arbeitgeber
hat
seinerseits
die
Verpflichtung,
alle
erforderlichen
Maßnahmen
zu ergreifen,
um die
Sicherheit
seiner
Arbeitnehmer
zu gewährleisten
und deren
Gesundheit
zu schützen,
in dem er
beruflichen
Risiken,
insbesondere
im Bereich
der
psychischen
Belästigung,
vorbeugt.
Seit
dem Urteil
vom 21. Juni
2006 knüpft
somit die
Haftung des
Arbeitgebers
direkt an
seine
Pflicht an,
die
Sicherheit
und
Gesundheit
der bei ihm
angestellten
Arbeitnehmer
zu gewährleisten.
Anders
ausgedrückt
bedeutet
dies, dass
allein
Zufall oder
höhere
Gewalt den
Arbeitgeber
von seiner
Haftungspflicht
im Falle der
psychischen
Belästigung
durch seine
Angestellten
befreien können.
 Befristeter
Arbeitsvertrag
um einen
abwesenden
Arbeitnehmer
zu vertreten
Befristeter
Arbeitsvertrag
um einen
abwesenden
Arbeitnehmer
zu vertreten
Der
Kassationshof
hat in zwei
Urteilen in
diesem
Sommer
entschieden,
dass ein
befristetes
Arbeitsverhältnis
nur für die
Vertretung
von jeweils
einem
abwesenden
Arbeitnehmer
abgeschlossen
werden darf
(Kassationshof,
28. Juni
2006, Nr.
04-40455, Nr.
04-43053).
Im
vorliegenden
Fall war ein
Arbeitnehmer
mittels
befristeten
Arbeitsvertrags
angestellt
worden, um
mehrere
hintereinander
abwesende
Arbeitnehmer
in der
Urlaubszeit
zu vertreten.
Obwohl die
Namen und
die
Qualifikationen
der zu
vertretenen
abwesenden
Arbeitnehmer
in dem
befristeten
Arbeitsvertrag
aufgeführt
waren, hat
der
Kassationshof
festgestellt,
dass aus dem
Artikel
L.122-1-1
des französischen
Arbeitsgesetzbuches
hervorgeht,
dass ein
befristetes
Arbeitsverhältnis
nur für die
Vertretung
von einem
einzigen
abwesenden
Arbeitnehmer
abgeschlossen
werden darf.
Daher
ist es
unbedingt
erforderlich,
dass für
die
Vertretung
von jedem
abwesenden
Arbeitnehmer
jeweils ein
getrennter
Arbeitsvertrag
erstellt
wird, der
den Namen
und die
Qualifikation
der
vertretenen
Person aufführt.
Diese
Rechtsprechung
hat
sicherlich
unangenehme
Auswirkungen
hinsichtlich
der
Personalverwaltung
und auch der
Kosten.
Beispielsweise
muss ein
Arbeitgeber
mit dem
Arbeitnehmer,
der während
der
Urlaubszeit
mehrere
abwesende
Arbeitnehmer
nacheinander
vertreten
wird,
mehrere
Arbeitsverträge
aufsetzen.
Auch darf
nicht
vergessen
werden, dass
das Gehalt
des
Arbeitnehmers,
der einen
abwesenden
Arbeitnehmer
vertritt,
mit dem
vertretenen
Arbeitnehmer
identisch
sein muss,
solange die
Qualifikation
und die
Funktionen
der beiden
gleichwertig
ist.
Daraus
ergibt sich,
dass ein
Arbeitnehmer,
der in einem
befristeten
Arbeitsverhältnis
steht, im
Laufe einer
ziemlich
kurzen
Periode sehr
unterschiedliche
Gehälter
erhalten
kann, welche
in Abhängigkeit
der Gehälter
sind, welche
die
vertretenen
Arbeitnehmer
erhalten. Es
kann sogar
passieren,
dass ein
Arbeitnehmer,
der
zeitgleich
zwei
Teilzeitarbeitnehmer
vertritt, für
denselben
Zeitraum
zwei
unterschiedliche
Gehälter
erhält. Zum
Beispiel ein
Gehalt für
die Arbeit,
die er am
Vormittag
verrichtet
und ein
davon
unterschiedliches
Gehalt für
die (gleiche)
Arbeit, die
er am
Nachmittag
verrichtet.
Außerdem
verfügt er
selbstverständlich
über zwei
verschiedene
Arbeitsverträge.
Die
praktischen
Auswirkungen
dieser
Rechtsprechung
finden
sicherlich
bei den
betroffenen
Unternehmen
keine
grenzenlose
Zustimmung!
 
 Aufteilungsgebühr bei einverständlicher
Scheidung
Aufteilungsgebühr bei einverständlicher
Scheidung
Die
französische
Verwaltung
hat bestätigt,
dass
Ehegatten,
die sich
einverständlich
scheiden
lassen, eine
Aufteilungsgebühr
zu zahlen
haben. Die
Aufteilung
von
beweglichen
und
unbeweglichen
Sachen
zwischen
Miteigentümern,
Miterben und
Mitgesellschaftern
ist in Höhe
von 1,1 %
entweder
aufgrund der
Eintragung
oder
aufgrund der
Offenlegung
der
Rechtsverhältnisse
an einem
Grundstück
gebührenpflichtig.
Eine solche
Gebühr wird
„Aufteilungsgebühr“
genannt (CGI,
art. 746).
Diese Gebühr
ist eine sog.
Urkundeneintragungsgebühr,
d.h. die Gebühr
wird erst fällig,
wenn sie in
einer öffentlichen
oder
privatschriftlichen
Urkunde
festgestellt
oder sogar
erörtert
worden ist.
Nun sind die
Ehegatten,
die sich
einverständlich
scheiden
lassen
wollen, seit
dem
Inkrafttreten
des Gesetzes
über die
Scheidung
vom 26. Mai
2004 (L.
n°
2004-439, 26
mai 2004, JO
27 mai 2004,
p. 9319)
dazu
verpflichtet,
dem Richter
eine
Vereinbarung,
die die
Rechtsfolgen
der
Scheidung
regelt, zur
Genehmigung
vorzulegen.
Diese
Vereinbarung,
die dem
Scheidungsantrag
beigefügt
ist, muss
eine die
Abwicklung
betreffende
Aufstellung
über die
Gesamtheit
der
ehelichen
Gemeinschaft
enthalten,
in der
gegebenenfalls
der
Verkaufspreis
des
gemeinsamen
Grundstücks
und die Art
und Weise,
wie die
Ehegatten es
aufteilen,
angegeben
sind. Die
Aufteilungsgebühr
wird dann
aufgrund des
Scheidungsurteils
geschuldet,
das die
Vereinbarung,
die die
Abwicklung
und
Aufteilung
des Güterstandes
der
Ehegatten
vorsieht,
gerichtlich
anerkennt (Rép.
min. à QE n°
86792, JOAN
Q, 13 juin
2006, p.
6208).
 Rundfunkgebühren für Computer mit Internetzugang
Rundfunkgebühren für Computer mit Internetzugang
Ab
dem 01.
Januar 2007
sind trotz
erheblicher
Kritik nach
dem derzeit
geltenden
Rundfunkgebührenstaatsvertrag
(RGebStV)
Rundfunkgebühren
für die
Computer zu
entrichten,
die
Rundfunkprogramme
(Hörfunk
und
Fernsehen)
ausschließlich
über
Angebote aus
dem Internet
wiedergeben
können. Im
nicht
ausschließlich
privaten
Bereich gilt
dies nicht,
wenn auf
demselben
Grundstück,
auf dem sich
der Computer
befindet,
oder auf
einem mit
diesem
Grundstück
räumlich
verbundenen
anderen
Grundstück
bereits ein
herkömmliches
Radio- oder
Fernsehgerät
vorhanden
ist. Ist
kein solches
Gerät
vorhanden,
so ist für
die
Gesamtheit
der Computer
mit
Internetzugang
eine
Rundfunkgebühr
zu bezahlen,
sofern sich
diese
Computer auf
ein und
demselben
Grundstück
oder auf räumlich
miteinander
verbundenen
Grundstücken
befinden.
Im
Ergebnis hat
deshalb ein
Unternehmen,
das über räumlich
voneinander
getrennte
Zweigstellen
oder
Niederlassungen
verfügt,
mehrere
Rundfunkgebühren
für die an
den
verschiedenen
Standorten
jeweils
vorhandene
Gesamtheit
der Computer
mit
Internetzugang
zu leisten.
Vielfach
wurde diese
Neuregelung
kritisiert,
da eine
Mehrfachbelastung
entstehe
weil
beispielsweise
ein selbstständiger
Unternehmer
neben den
Gebühren für
die private
Nutzung noch
die Gebühren
für das
Autoradio im
Firmenwagen
und für die
Internet-PCs
entrichten müsse.
Allerdings
muss die Gebühr
für die
Computer
dann nicht
bezahlt
werden, wenn
der
Firmenwagen
(Autoradio)
und die
Computer ein
und
demselben
Grundstück
oder räumlich
miteinander
verbundenen
Grundstücken
zuzuordnen
sind. Diese
Zuordnung
ist
anzunehmen,
wenn der
Firmenwagen
in
Inventarverzeichnissen
oder auf
vergleichbare
Weise für
das Grundstück,
auf dem sich
der Computer
befindet,
dokumentiert
ist
Sobald
ein PC mit
Internetzugang
in der
Privatwohnung
teilweise
auch für
berufliche
Zwecke
genutzt wird,
ist dafür
ebenfalls
eine Gebühr
zu leisten.
Diese Gebühr
entfällt
wiederum
dann, wenn
in derselben
Privatwohnung
bereits ein
herkömmliches
Radio- oder
Fernsehgerät
zum Empfang
bereitgehalten
wird.
 Bundesjustizministerium
eröffnet
fremdsprachiges
Angebot
deutscher
Gesetze im
Internet
Bundesjustizministerium
eröffnet
fremdsprachiges
Angebot
deutscher
Gesetze im
Internet
Der
neue Service
ermöglicht
laut
Ministerium
einen
Einblick in
das deutsche
Privatrecht
und baut das
Rechtsinformationsangebot
auf einem
wichtigen
Gebiet aus.
Als erstes
hat das
Ministerium
das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB)
ins
Englische übersetzen
lassen. Es
kann unter
folgender
Adresse
kostenfrei
abgerufen
werden: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html.
Bei der
neuen
englischen
Fassung des
BGB soll es
nicht
bleiben, das
Bundesjustizministerium
plant das
fremdsprachige
Angebot
deutscher
Gesetze
kontinuierlich
zu erweitern.
|