|
>
Steuerrecht
>
Gesellschaftsrecht
>
Arbeitsrecht
>
Verschiedenes

 Europarecht
Europarecht
 Deutsches
Recht
Deutsches
Recht
 Französisches
Recht
Französisches
Recht

 Umsatzsteuer
– ausländische
Unternehmen
–
Verlagerung
der
Steuerschuldnerschaft
Umsatzsteuer
– ausländische
Unternehmen
–
Verlagerung
der
Steuerschuldnerschaft
Gegenwärtig
sind in
Frankreich
nicht ansässige
Unternehmen,
welche in
Frankreich
steuerpflichtige
Tätigkeiten
durchführen,
grundsätzlich
bezüglich
dieser Tätigkeiten
in
Frankreich
Umsatzsteuerschuldner.
Um die
Steuerbetrugsrisiken
zu vermeiden
wurde durch
das Ergänzungshaushaltgesetz
für 2005
eine neue
Regelung
eingeführt.
Diese
bezweckt die
Vereinheitlichung
der
Verlagerung
der Steuerschuldnerschaft
der
Umsatzsteuer
auf den
Kunden für
sämtliche
in
Frankreich
steuerpflichtigen
Warenlieferungen
und
Dienstleistungen,
die durch im
Ausland ansässige
Unternehmen
zugunsten
von in
Frankreich
umsatzsteuerpflichtigen
Unternehmen
durchgeführt
wurden.
Um diese
neue
Regelung
umsetzen zu
können, ist
die fällige
Umsatzsteuer
im Fall von
in
Frankreich
steuerpflichtigen
Warenlieferungen
und
Dienstleistungen,
welche durch
nicht in
Frankreich
ansässige
Unternehmen
durchgeführt
wurden,
durch den Käufer,
den Waren-
oder
Dienstleistungsempfänger
zu
entrichten.
Diese neue
Regelung der
Verlagerung
der
Steuerschuldnerschaft
findet
jedoch nur
dann
Anwendung,
wenn der Käufer,
Waren- oder
Dienstleistungsempfänger
über eine
Umsatzsteueridentifikationsnummer
in
Frankreich
verfügt.
In der
Praxis
betrifft die
neue
Regelung die
nachfolgenden
in
Frankreich
von ausländischen
Unternehmen
ausgeführten
Tätigkeiten:
interne
Lieferungen,
Lieferungen,
die nach
Installation
oder Montage
erfolgen,
die mit
einer in
Frankreich
befindlichen
Immobilie
zusammenhängenden
Dienstleistungen,
kulturelle,
sportliche,
wissenschaftliche
und
erzieherische
Dienstleistungen,
Unterhaltungs-
und
Transportdienstleistungen,
mit der
Ausnahme von
innergemeinschaftlichen
Transportdienstleistungen
sowie
hiermit
verbundene
Dienstleistungen.

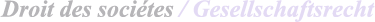
 Grenzüberschreitende Fusionen in der EU
Grenzüberschreitende Fusionen in der EU
Am 15. Dezember 2005 ist die Europäische Richtlinie über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (RL 2005/56/EG) in Kraft getreten. Sie ist bis spätestens Dezember 2007 in nationales Recht
umzusetzen.
Die Richtlinie ergänzt die Regeln zur Europäischen Aktiengesellschaft (SE), bei der eine der wichtigsten Gründungsformen gerade die grenzüberschreitende Verschmelzung ist, und die SEVIC-Entscheidung des EuGH, in der der Gerichtshof erst kürzlich entschieden hat, dass ein Mitgliedstaat Umwandlungen unter Beteiligungen von Kapitalgesellschaften aus einem anderen Mitgliedstaat ermöglichen muss. Sie schliesst mithin eine wichtige Lücke im
Gesellschaftsrecht.
Die Richtlinie soll vor allem kleinen und mittleren Kapitalgesellschaften helfen, die über ihren eigenen Mitgliedstaat hinaus tätig sein wollen, nicht aber unionsweit und deshalb kaum von der Möglichkeit Gebrauch machen dürften, eine Europäische Aktiengesellschaft zu gründen. Nach dem in der Richtlinie geregelten Verfahren sollen für solche grenzüberschreitenden Fusionen die in dem betreffenden Mitgliedstaat im Inland geltenden Grundsätze und Vorschriften anwendbar sein.
In Zukunft wird also beispielsweise eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) problemlos mit einer französischen Société à responsabilité limitée
(Sàrl) verschmelzbar sein und umgekehrt. Vor allem der deutsche Mittelstand oder französische PMEs können dadurch sehr viel einfacher als bisher über Landesgrenzen hinweg Kooperationen eingehen und Umstrukturierungen
durchführen.
 Bestellung eines GmbH-Geschäftsführers unter auflösender Bedingung
Bestellung eines GmbH-Geschäftsführers unter auflösender Bedingung
Der BGH hat mit Urteil vom 24. Oktober 2005 entschieden, dass der Geschäftsführer einer GmbH unter einer auflösenden Bedingung bestellt werden kann. Er grenzt sich somit von der bisherigen herrschenden Meinung in der Rechtsliteratur ab. Hintergrund dieser Entscheidung war ein Gesellschafterbeschluss, der ein automatisches Ausscheiden des Geschäftsführers vorsah, wenn der Geschäftsführer seine volle Arbeitskraft nicht bis zu einem bestimmten Datum der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Hierdurch sollte ihm die Möglichkeit eröffnet werden, sein Engagement in einer anderen Gesellschaft nicht überstürzt beenden zu müssen. Da der bestellte Geschäftsführer jedoch in der anderen Gesellschaft entgegen der Regelung weiter tätig blieb, klagte die Gesellschaft auf Feststellung der Beendigung der Geschäftsführerstellung. Der BGH hat der Klage stattgegeben. Ein Widerspruch zum Bedürfnis nach Rechtssicherheit im geschäftlichen Verkehr, wonach für jedermann deutlich sein muss, wer die gesetzlichen Pflichten des Geschäftsführers zu erfüllen hat, besteht nicht. Ferner werden hierdurch auch keine Gläubigerschutzbelange beeinträchtigt. Sollte der Geschäftsführer nach Eintritt der Bedingung weiter rechtsgeschäftlich für die GmbH tätig werden, könne der redliche Geschäftsverkehr auf die noch im Handelsregister eingetragene und somit fortbestehende Vertretungsmacht des Geschäftsführers vertrauen. Eine Geschäftsführerbestellung unter auflösender Bedingung kann folglich im Einzelfall eine interessante Variante
darstellen.
 Fällige
Registersteuern
bei der
Abtretung
von Anteilen
an
Gesellschaften
Fällige
Registersteuern
bei der
Abtretung
von Anteilen
an
Gesellschaften
Wir
erinnern
daran, dass
die Steuersätze
für die
Registrierung
der
Abtretung
von Anteilen
an
Gesellschaften
durch das
Nachtragshaushaltsgesetz
für 2004 (Gesetz
Nr.
2004-1485
vom 30.
Dezember
2004) mit
Wirkung ab
1. Januar
2006 geändert
wurden.
Insofern
unterliegt
die
Abtretung
von Anteilen
an
Gesellschaften
fortan
folgenden
Registersteuersätzen:
- 1,10
% (1 %
vor
2006),
gedeckelt
auf
4.000
€ pro
Abtretung
(3.049
€ vor
2006), für
die
Abtretung
von
Aktien (hiervon
ausgenommen
sind
nicht-börsennotierte
Gesellschaften,
deren
Aktiva
überwiegend
aus
Immobilien
bestehen);
- 5
% (4,80
% vor
2006) für
die
Abtretung
von
Geschäftsanteilen
(v.a.
SARL,
Gesellschaften
bürgerlichen
Rechts)
oder von
nicht-börsennotierten
Gesellschaften,
deren
Aktiva
überwiegend
aus
Immobilien
bestehen.
Im
Übrigen
kann bei der
Abtretung
von Geschäftsanteilen
auch
weiterhin
ein
Freibetrag
in Höhe von
23.000 €
von der
Bemessungsgrundlage,
auf die die
5 %
anzuwenden
sind,
abgezogen
werden.
Dabei gilt
zu beachten,
dass sich
dieser
maximale
Freibetrag
von 23.000
€ auf alle
Geschäftsanteile
einer
Gesellschaft
bezieht.
Insofern wäre
bei einer
Abtretung
der Hälfte
der Anteile
einer
Gesellschaft
der
Kaufpreis für
diese
Abtretung,
der als
Berechnungsgrundlage
für die 5 %
Registersteuer
heranzuziehen
ist, um
11.500 €
zu
reduzieren.

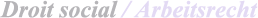
 Nachbesserung bei der Besteuerung von Abfindungen
Nachbesserung bei der Besteuerung von Abfindungen
Wie bereits in der Januarausgabe unseres Newsletters berichtet, wurde von der neuen Bundesregierung die Streichung der steuerlichen Freibeträge für Abfindungen (zwischen 7.200 € und 10.800 €) beschlossen, die nach dem 31. Dezember 2005 vereinbart wurden. Vertrauensschutz für die Gewährung der Freibeträge sollte nach bisheriger Regelung nur dann bestehen, wenn die Auszahlung der Abfindung bis zum 31. Dezember 2006 erfolgt.
Nunmehr wurde der Zeitraum für Vertrauensschutz verlängert. Abfindungsvereinbarungen bei einer vom Arbeitgeber oder vom Gericht veranlassten Aufhebung des Dienstverhältnisses, die vor dem 31. Dezember 2005 geschlossen
wurden, können noch von den alten Freibeträgen
profitieren, wenn die Zahlung der Abfindung bis spätestens zum 31. Dezember 2007
erfolgt.
 Beschäftigungssicherungsklausel in der Insolvenz
Beschäftigungssicherungsklausel in der Insolvenz
Das Bundesarbeitsgericht hat am 17. November 2005 (6 AZR 107/05) entschieden, dass Vereinbarungen zur Standortsicherung, die betriebsbedingte Kündigungen für einen bestimmten Zeitraum ausschließen und vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens getroffen wurden, vom Insolvenzverwalter nicht berücksichtigt werden müssen. In dem zu entscheidenden Fall hatten Unternehmen und Betriebsrat vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen befristeten Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen gegen Lohnverzicht vereinbart. Der Insolvenzverwalter, der im Rahmen des Insolvenzverfahrens einen Teilbetrieb stilllegen
wollte, fühlte sich an die Vereinbarung nicht gebunden und kündigte betriebsbedingt vor Auslaufen der vereinbarten
Standortsicherungsvereinbarung.
 Vorschläge
für einen
neuen
Arbeitsplatz
im Rahmen
der
betriebsbedingten
Kündigung
Vorschläge
für einen
neuen
Arbeitsplatz
im Rahmen
der
betriebsbedingten
Kündigung
In
Frankreich
besteht für
den
Arbeitgeber
die Pflicht,
vor einer
betriebsbedingten
Kündigung
einen neuen
Arbeitsplatz
für die zu
entlassenden
Arbeitnehmer
zu suchen.
Im April
2005 ist
eine Polemik
entstanden,
als ein im
Elsass
gelegenes
Unternehmen
seinen zu
entlassenden
Arbeitnehmern
Arbeitsplätze
in Rumänien
angeboten
hat. Dieser
Vorschlag
ist als „Pseudowiedereingliederung“
bewertet
worden, da
dies als „nicht
seriös“
angesehen
wurde. Eine
Behörde,
die zum
Arbeitsministerium
gehört, hat
als Reaktion
darauf
nunmehr eine
Verwaltungsvorschrift
erlassen.
Danach kann
„ein
Vorschlag
eines
Unternehmens
bezüglich
von Posten
innerhalb
der Gruppe,
die im
Ausland
belegen sind,
nicht als
seriös
angesehen
werden, wenn
das Gehalt
stark
unterhalb
des SMIC (=
französischer
gesetzlicher
Mindestlohn,
z. Zt.
1.357,07 €
für 169
Stunden/Monat)
liegt.
Sollte ein
derartiger
„nicht
seriöser“
Vorschlag
gemacht
worden sein,
so ist die
zuständige
Arbeitsbehörde
gehalten,
von dem
Arbeitgeber
die Rücknahme
dieses
Vorschlags
zu verlangen.
Dies hätte
wiederum zur
Folge, dass
eine
betriebsbedingte
Kündigung
dann möglicherweise
unbegründet
sein könnte.
 
 Die Prüfpflicht
des
Auftraggebenden
Unternehmens
in Fällen
der
Arbeitnehmerüberlassung
durch
Subunternehmer
Die Prüfpflicht
des
Auftraggebenden
Unternehmens
in Fällen
der
Arbeitnehmerüberlassung
durch
Subunternehmer
Durch
Einführung
umfangreicher
Regelungen
hat der
französische
Gesetzgeber
den Schutz
der
Angestellten
von
Subunternehmen,
die zur Verfügung
eines
auftraggebenden
Unternehmens
gestellt
werden und
von deren
Arbeiten
dieser
Auftraggeber
profitiert,
verstärkt.
Danach
haftet der
Auftraggeber
in Fällen,
in denen der
Auftrag
3.000 Euro
übersteigt,
gesamtschuldnerisch
mit dem
Subunternehmen
für Steuern,
Abgaben,
Pflichtbeiträge,
Strafen,
Entschädigungen
und Lasten
in Bezug auf
das
Arbeitsverhältnis
dieser
Angestellten.
In gleicher
Weise kann der
Auftraggeber
zur Zahlung
einiger
dieser Beträge
herangezogen
werden, wenn
an dem Geschäft
drei
verschiedene
Parteien (Hauptauftraggeber
–
Auftragnehmer
–
Subunternehmer)
beteiligt
sind.
Eine neuere
Rechtsprechung
hat den
Umfang der
Verpflichtungen
des
Auftraggebers
zur Überprüfung
vergrößert.
Dieser läuft
künftig
Gefahr, bei
Verletzung
dieser Prüfpflicht
gemeinsam
mit dem
Subunternehmer
strafrechtlich
verantwortlich
zu sein.
|
|